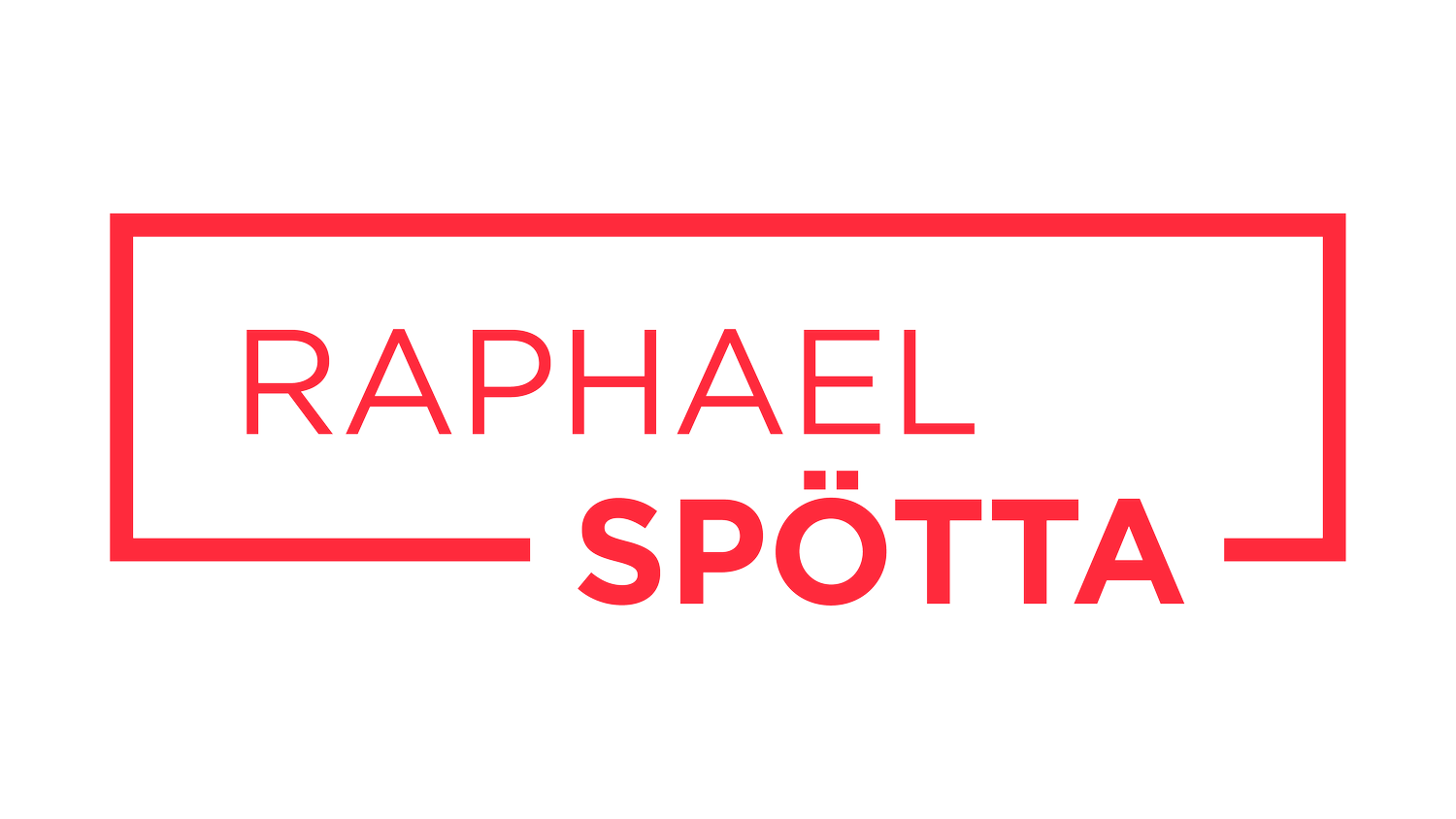Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Am 14. September 2019 griffen jemenitische Huthi-Rebellen die saudische Ölraffinerie bei Abqaiq sowie das große Ölfeld bei Khurais mit Drohnen und Marschflugkörpern an. Es war zwar nicht der erste Angriff gegen die Erdöl-Infrastruktur Saudi-Arabiens, aber zweifellos einer der schwersten. Dieser Angriff sorgte dafür, dass die saudische Ölproduktion quasi über Nacht um die Hälfte einbrach und führte der saudischen Königsfamilie die eigene Angreifbarkeit deutlich vor Augen. Die verwendeten Drohnen und Raketen der Huthis waren angeblich iranischer Bauart. Der Iran unterstützt die Huthis bei ihrem Krieg im Jemen, in den auch Saudi-Arabien 2015 eingegriffen hatte.
Die Geschichte der Feindseligkeit zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ist lang und facettenreich. Es wäre unzulässig verkürzend, diese Rivalität zwischen beiden Staaten ausschließlich auf die religiöse Komponente zu reduzieren – der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran ist nicht bloß ein Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Vieles geht auf die iranische Revolution und den Sturz des Schah 1979 zurück. Seit damals befürchtet das saudische Königshaus, dass der Iran Aufstände oder gar eine Revolution gegen das saudische Königshaus anzetteln könnte. Unter der Führung Khomeinis wurde der Iran zu einer theokratischen Republik und damit zum Gegenentwurf zur absoluten, wahhabitischen Monarchie Saudi-Arabiens.
Ein Klima der Feindseligkeit entstand, gepaart mit ideologischer Konkurrenz. Dies löste letzten Endes einen Konflikt um die Vormachtstellung am Persischen Golf aus. Der Kalte Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran verschärfte zahlreiche, teilweise bewaffnete Konflikte im Nahen Osten, die zu Stellvertreterkonflikten wurden: die Kriege in Syrien und dem Jemen, der politische Konflikt im Libanon und die volatile Sicherheitslage im Irak – all diese Konflikte sind von diesem Kalten Krieg zwischen Riyad und Teheran betroffen. Dieser Kalte Krieg hat Auswirkungen auf die gesamte Region.
Tauwetter am Persischen Golf
In letzter Zeit wurde es ruhiger um diesen Konflikt. Zwar wusste man, dass sich Vertreter beider Staaten im Irak zu Gesprächen getroffen hatten, um über die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zu verhandeln. Überraschend war jedoch die Ankündigung, dass Saudi-Arabien und der Iran tatsächlich wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen wollten – und, dass China diese Einigung vermittelt hatte. Es ist der erste größere Schritt beider Mächte in Richtung Entspannung seit der Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Nimr an-Nimr durch Saudi-Arabien Anfang 2016.
Diese Einigung nutzt beiden Staaten und könnte den Nahen Osten, eine ansonsten enorm volatile Weltregion, weitgehend stabilisieren. Riyad verspricht sich von diesem Abkommen insofern eine verbesserte sicherheitspolitische Position, als es damit rechnet, dass sowohl Russland, aber auch vor allem China mäßigend auf den Iran einwirken werden. Teheran, auf der anderen Seite, erwartet, dass Saudi-Arabien die Finanzierung des oppositionellen Nachrichtenmediums „Iran International“ einstellt, sich komplett aus dem Jemen zurückzieht und die Huthis als legitime Autorität anerkennt, damit aufhört, iranische Oppositionsgruppen zu unterstützen und den Druck auf die schiitische Bevölkerungsminderheit reduziert.
China nutzt eine Gelegenheit
Sowohl Saudi-Arabien als auch der Iran profitieren von diesem Abkommen. Darüber hinaus haben sie China zu einem wesentlichen diplomatischen Sieg verholfen. Hatten sich diese beiden Staaten zuvor bereits im Oman und im Irak zu Gesprächsrunden getroffen, waren es jedoch weder der omanische Sultan noch der irakische Premierminister, der die Einigung zwischen diesen beiden Parteien vermittelt haben, sondern China. China ist damit ein signifikanter diplomatischer Erfolg gelungen, der die außenpolitische Position Beijings ungemein stärkt. Traditionell zurückhaltend, drängte Chinas Außenpolitik mit der Vermittlung im saudisch-iranischen Konflikt jedoch ins Zentrum der Weltbühne. Chinas Interesse an diesem Konflikt ist jedoch rein ökonomischer Natur – es hat also keine Eigeninteressen, die wesentlich über eine Stabilisierung der Region hinausgehen. China hat Interesse an einem stabilen Nahen Osten, da es einen signifikanten Anteil seiner Energieressourcen über die Golfregion bezieht. Das macht es in diesem Fall zu einer neutralen Partei, die zwischen den beiden Konfliktparteien vermitteln konnte.
Chinas Erfolg ist jedoch vor allem der strategischen Situation im Nahen Osten geschuldet. Anders ausgedrückt: China war lediglich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Die USA oder ihre Verbündeten waren nicht dazu in der Lage, zwischen den beiden Konfliktparteien zu vermitteln. Einerseits haben die USA keine offiziellen Beziehungen zum Iran und auch um die inoffiziellen Beziehungen steht es nicht zum Besten. Auch die US-Beziehungen zu Saudi-Arabien sind belastet – aufgrund der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 wollte Joe Biden Saudi-Arabien international zum „Paria“ machen. Aufgrund steigender Benzinpreise versuchte Biden dann, Saudi-Arabien davon zu überzeugen, die Ölfördermenge im Rahmen der OPEC zu erhöhen. Das würde nicht nur den Preis für die US-Verbraucher:innen reduzieren, sondern auch Russlands Einnahmen. Entgegen einer entsprechenden Zusicherung aus Riyad drosselte die OPEC die Ölfördermenge – zwei Mal.
Die USA waren also weder dazu in der Lage, eine Vermittlerrolle einzunehmen, noch als „Ordnungsmacht“ im Nahen Osten aufzutreten. Sie haben sich politisch ins Abseits manövriert und das wurde durch China ausgenutzt. Für Biden ist das eine schwerwiegende politische Niederlage. Gleichzeitig wirft dieser Umstand die Frage auf, ob es sich bei der Vermittlung durch China um einen Aufstieg zur diplomatischen Großmacht handelt oder eher um einen nicht wiederholbaren Erfolg.
Keine neue Ordnungsmacht
Aktuell scheint eher Letzteres der Fall zu sein. Beijing konnte eine sich bietende Gelegenheit ausnutzen und hatte damit in diesem einen Fall Erfolg. Andere Vermittlungsversuche durch China waren nicht annähernd so erfolgreich, etwa am Horn von Afrika, in Myanmar, in Nordkorea oder auch im Konflikt zwischen Israel und Palästina. Im Falle des Konflikts zwischen Saudi-Arabien und dem Iran lagen die Faktoren günstig. Das macht China jedoch nicht zu einer belastbaren diplomatischen Macht; ein solcher Fall ist nur sehr bedingt wiederholbar. Gleichzeitig verschafft dieser Erfolg China auch etwas, das es für internationale Vermittlungsversuche dringend braucht: Glaubwürdigkeit. Dabei gibt es jedoch einen Haken. Der Deal zwischen beiden Parteien muss halten, ansonsten bleibt Chinas Bilanz im Friedensstiften bestenfalls lückenhaft.
Wie nachhaltig dieser Friedensschluss sein wird, muss an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. Ob sich die beiden Staaten nachhaltig annähern werden, hängt davon ab, ob sie sich auch dauerhaft an die Bedingungen des Abkommens halten werden. Ausgemacht ist das nicht: mit der schlichten Wiedereröffnung diplomatischer Vertretungen ist es nicht getan. Der Kalte Krieg zwischen beiden Staaten war bereits im Gange, als die beiden Staaten noch diplomatische Beziehungen unterhielten. Beide müssten sich, um den Konflikt zumindest nachhaltig einzuhegen, auf Dauer an die Vereinbarungen und Bedingungen halten.
Zudem ist die Frage, wie sich Israel verhalten wird. Aktuell befindet sich die israelische Regierung in einer veritablen Krise aufgrund der geplanten Justizreform und den Protesten gegen diese Entmachtung des Obersten Gerichtshofs. Doch Israel fürchtet die potenzielle Normalisierung mit dem Iran, in erster Linie natürlich, da die Islamische Republik Israel das Existenzrecht abspricht.
Eine Annäherung zwischen Riyad und Teheran versetzt den israelischen Bemühungen einen herben Rückschlag, selbst ein Abkommen mit Saudi-Arabien zu schließen und so auf den sogenannten „Abraham Accords“ aufzubauen. Eine Normalisierung mit Saudi-Arabien hätte für Israel eine ganz wesentliche Änderung des Status’ in der Region zur Folge gehabt. Jedenfalls wurde der Hoffnung Israels, dass sich mit den Abraham Accords ein Anti-Iran-Block bilden lassen könnte, ein schwerwiegender Dämpfer versetzt. China ist kurz- bis mittelfristig sicherlich nicht dazu in der Lage, alle Faktoren im Nahen Osten zu beeinflussen, insbesondere, wenn Staaten ein Interesse daran haben, dass der Deal nicht halten wird.
Seitenlinien
Nicht nur die USA haben sich bei den Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran plötzlich an der Seitenlinie wiedergefunden. Dass Europa und damit auch Österreich erneut an der Seitenlinie gestanden und damit erneut bloß zu Zuschauern degradiert wurden, ist nicht überraschend und äußerst frustrierend. Tatsächlich spielten europäische Staaten im Nahen Osten seit der Suezkrise 1956 de facto keine Rolle mehr. Mit der Formierung der Europäischen Union würde das Potenzial bestehen, derartige Gelegenheiten nun auch wahrzunehmen, zumal auch Europa ein veritables Interesse an der Beilegung von Konflikten wie jenen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hat. Obwohl jedoch ein Ende des Kalten Kriegs am Golf für Europa von hoher Relevanz ist, war es nicht möglich, eine solche sich bietende Gelegenheit zu ergreifen. Zu viele Partikularinteressen bestimmen die europäische Außenpolitik und zu wenig Vertrauen herrscht offensichtlich gegenüber Europa.
Besteht nun auch das Potenzial, dass Beijing in weiteren Konflikten versucht, diplomatisch zu vermitteln und mit welchen Aussichten? Es ist zwar davon auszugehen, dass China es versucht, etwa in der Ukraine: hier hat Xi Jinping bereits einen 12-Punkte-Plan für die Beilegung des Konflikts vorgestellt. Allerdings hat China mit seiner Partnerschaft mit Russland sowohl ein politisches Naheverhältnis zum Aggressor (womit es gegenüber der Ukraine auch nicht als neutraler Vermittler auftreten kann) als auch einen eher unglaubwürdigen Track Record bei der Vermittlung in derartigen Konflikten. Es wirkt darüber hinaus so, als sei Beijing nicht dazu in der Lage oder nicht gewillt, Druck auf Russland auszuüben, um Moskau an den Verhandlungstisch zu zwingen. Da bei Verhandlungen über eine Nachkriegsordnung in Europa sowohl die USA als auch die EU mit am Tisch sitzen wollen (und müssen), erscheint eine chinesische Vermittlung immer unwahrscheinlicher.
Ausblick
Diese Woche trafen sich die Außenminister Saudi-Arabiens und des Iran in Beijing, um ihr Abkommen zu finalisieren, und um über die Details der Wiedereröffnung der jeweiligen Botschaften zu sprechen. Weitere Punkte, die auf dem Programm standen, waren die Wiederaufnahme von Flugverbindungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran und die Visavergabe – und nicht zuletzt ein möglicher Besuch des iranischen Präsidenten Raisi in Saudi-Arabien. Die beiden Staaten machen also ernst, aber noch muss sich weisen, ob diese Détente nachhaltig sein wird und sein kann. Aber selbst, wenn sie auf diesem Abkommen aufbauen und die bilateralen Beziehungen verbessern können, ist es alles andere als sicher, dass Saudi-Arabien und der Iran zu einem guten Einvernehmen gelangen oder gar ein Bündnis eingehen würden.
Kurzfristig ist jedenfalls mit einer Entspannung in verschiedenen Konflikten im Nahen Osten zu rechnen, etwa im Jemen. Ob sich diese nachhaltig stabilisieren oder gar lösen lassen, hängt von den weiteren Schritten und dem Erfolg Riyads und Teherans ab, ihr Übereinkommen tatsächlich zu implementieren. Gleichzeitig hat Israel veritables Interesse daran, eine Normalisierung mit dem Iran politisch und diplomatisch zu sabotieren – ein Faktor, der künftig zu berücksichtigen sein wird, betrachtet man die saudisch-iranischen Beziehungen. Auch aus Washington sind Zweifel daran zu vernehmen, dass das gegenwärtige Tauwetter zu einer nachhaltigen Stabilisierung der Region führen wird. Zu wenig verlässlich sei der Iran, zu komplex die politisch-strategische Lage in der Region. Tatsächlich wirft das nunmehr auch die Frage auf, wie es nun mit dem Atomprogramm des Iran weitergehen wird – und, welche Schritte Saudi-Arabien mit einem eigenen Atomprogramm setzen wird.
Faktum ist, dass die Zukunft dieses Übereinkommens zwischen Saudi-Arabien und dem Iran unsicher ist. Es ist noch unklar, ob der Deal halten wird, ob sich beide Parteien vollumfänglich daran halten, und vor allem, ob es weiterhin eine neutrale dritte Partei geben wird, die zwischen den beiden vermitteln und einen Ausgleich herstellen kann. Dass China diese Ordnungsmacht sein kann, ist möglich, aber nicht ausgemacht. Die chinesische Vermittlung war deswegen möglich, da die meisten äußeren Umstände für Beijing günstig gelegen waren. Auf einem solchen diplomatischen Erfolg aufzubauen wäre jedoch eine Herausforderung.
Planet Labs, Inc.; CC BY-NC 2.0
Keine Änderungen vorgenommen