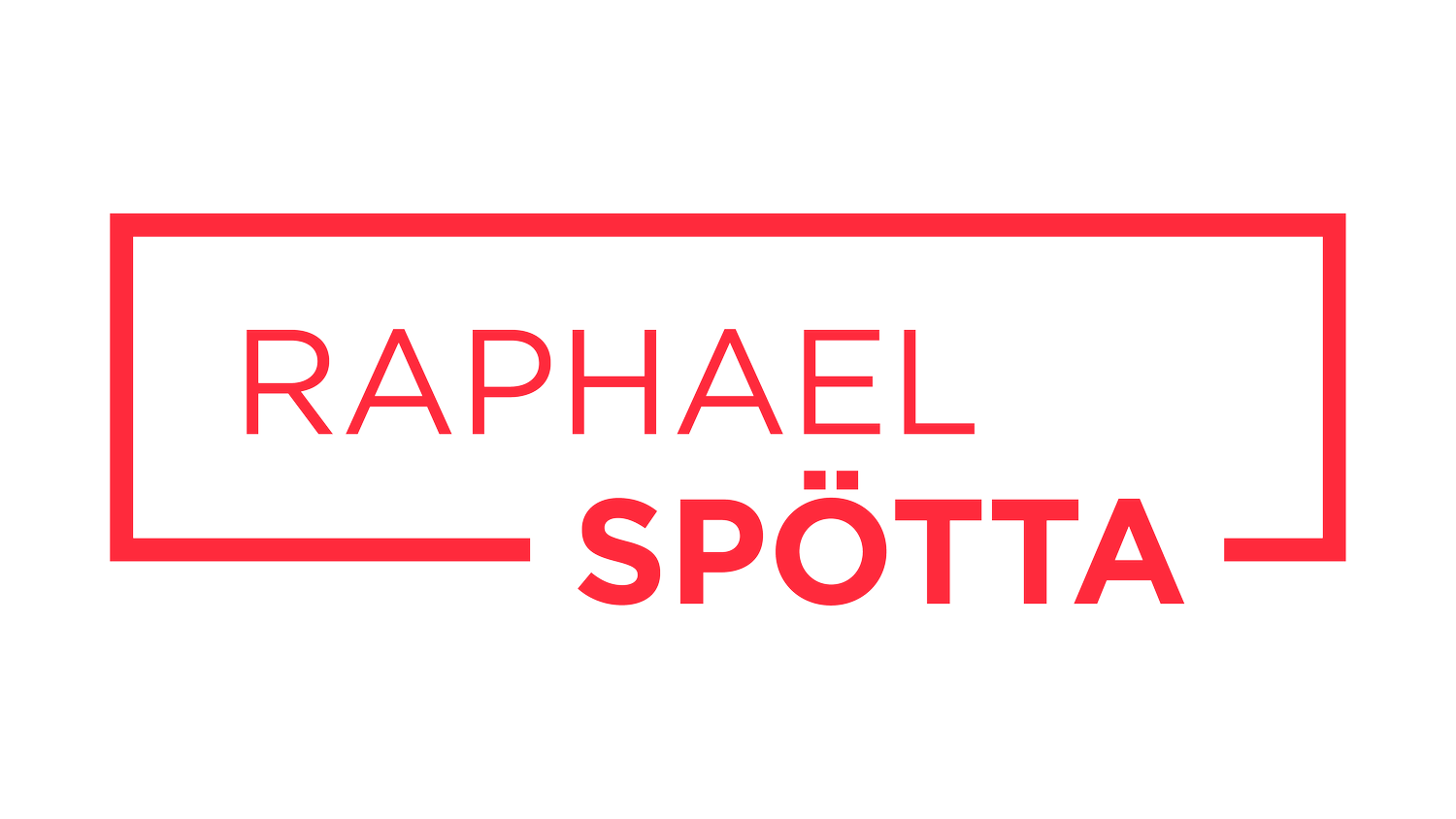Die Union im Wandel
Europa dürfe nicht zum Vasallen werden und sich nicht in einen Konflikt um Taiwan hineinziehen lassen. Mit diesen Worten ließ Frankreichs Staatspräsident Macron Anfang April in einem Interview aufhorchen. Europa, so Macron, müsse zum „dritten Pol“ werden, zwischen den USA und China. Neu war diese Haltung nicht, immerhin befürwortete gerade Frankreich stärkere Integration im außenpolitischen Bereich, insbesondere dann, wenn die Union Frankreichs Führungsrolle akzeptierte.
In diesem Fall ließen entrüstete Reaktionen jedoch nicht lange auf sich warten: Macron tätigte diese Aussagen nämlich ausgerechnet nach seinem Staatsbesuch in China und während einer chinesischen Militärübung um Taiwan, bei der die Abriegelung der Insel geübt wurde. Vor diesem Hintergrund signalisierte Macron, dass sich Europa in einem potenziellen militärischen Konflikt neutral verhalten würde.
„Mujtaba Rahman, the head of Europe at the research firm Eurasia Group, said the timing of Macron’s latest comments was poor. ‘To make these remarks as Chinese military exercises encircled Taiwan – and just after his state visit to China – was a mistake. It will be interpreted as appeasement of Beijing and a green light to Chinese aggression.’” (The Guardian)
Gerade diese Aussage Macrons wirft die Frage auf, wer eigentlich die außen- und sicherheitspolitische Position der Europäischen Union, gerade auch gegenüber China, vertritt. Macron wurde bei seinem Staatsbesuch in Beijing nämlich auch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begleitet. Anders als Macron hatte diese allerdings den Anspruch, eine „härtere Haltung“ gegenüber China zu vertreten. Wer vertritt nun allerdings die Union? Auf dem Papier wäre die Antwort klar: von der Leyen. Doch die realpolitischen Verhältnisse in der Union messen den Mitgliedsstaaten, besonders Frankreich und Deutschland, eine führende Rolle bei. Das führt jedoch zur weiteren Verkomplizierung der Situation, denn außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen der EU, die im Rat einstimmig getroffen werden müssen, stehen neben einer eigenständigen Außenpolitik der Mitgliedsstaaten, die über den jeweils erzielbaren Minimalkompromiss im Rat hinausgehen.
Effizientere Entscheidungsfindung
Diese strategische Kakofonie ist der beste Beleg dafür, dass der Politikbereich der Außen- und Sicherheitspolitik der Union reformbedürftig ist. Das im Rat herrschende Einstimmigkeitsprinzip sorgt dafür, dass einzelne EU-Mitgliedsstaaten Entscheidungen verzögern oder gänzlich blockieren können, was die Union als solche häufig langsamer und unflexibler macht, als es nötig wäre.
Indirekt sorgt dieses System auch dafür, dass die Rolle der Mitgliedsstaaten gestärkt wird, jedoch zulasten kleinerer Staaten. Gerade im Bereich der Außenpolitik treffen größere Mitgliedsstaaten wie Frankreich und Deutschland eigene außenpolitische Entscheidungen – und nehmen so für sich in Anspruch, eine Führungsrolle im gemeinsamen Europa einzunehmen. Ein solcher Anspruch ist demokratisch nur schwer zu legitimieren; der deutsche Bundeskanzler oder der französische Staatspräsident sind nicht von der Mehrheit der europäischen Wähler:innen gewählt. Und wenngleich auch von der Leyen selbst als Kommissionspräsidentin auch nicht europaweit gewählt wurde, wäre sie zumindest vom Europaparlament eher dazu legitimiert, die Union zu vertreten.
Eine sinnvolle Lösung für diese Problematik wäre die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat der EU und die Einführung einer qualifizierten Mehrheit bei außenpolitischen Entscheidungen, ebenso wie es bereits in anderen Politikfeldern der Fall ist. Eine solche Reform müsste allerdings auch beinhalten, dass die jeweiligen nationalen Außenpolitiken nicht mit jener im Rat festgelegten Position im Widerspruch stehen dürfen. Wäre das nicht der Fall, würde das die avisierte Effizienzsteigerung ad absurdum führen.
Internationale Herausforderungen
Die aktuelle internationale Lage erhöht in diesem Zusammenhang den Handlungsdruck. Die globale Sicherheitsordnung ist im Umbruch begriffen, die EU muss sich entscheiden, wie ihre Kooperation mit anderen internationalen Playern wie den USA oder auch China künftig aussehen soll. Sie könnte wesentlich stärker als bisher bei der Lösung internationaler Konflikte auftreten. Aufgrund der immer rascheren Entwicklung in der Digitalisierung und im Bereich der Künstlichen Intelligenz ist die Union auch als internationale Vorreiterin gefordert, gewisse Regeln und Regulierungen vorzuschlagen. Und nicht zuletzt stellt der Klimawandel Europa und die Welt vor enorme Herausforderungen.
Gerade der Klimawandel sollte Ansporn dafür sein, proaktive und ambitionierte Diplomatie zu betreiben, um doch noch zu versuchen, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperator auf 1,5 °C im Vergleich mit dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Mit dem heuer beschlossenen Paket „Fit for 55“ mag die EU in ihrem eigenen Bereich versuchen, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, eine Herausforderung wie die Klimakrise benötigt allerdings globale Anstrengungen. Mechanismen, wie der CO2-Grenzausgleichsmechanismus CBAM, verdeutlichen, dass die EU grundsätzlich auch ihre Handelsmacht dazu einzusetzen gewillt ist, um Anreize für Handelspartner zu schaffen, um zu dekarbonisieren. Doch auch in der europäischen Außenpolitik muss die Bekämpfung des Klimawandels zu einer Priorität werden – womit außenpolitische Effizienzsteigerungen unumgänglich werden.
Österreichische Rolle
Europäische Politik ist keine Einbahnstraße. Österreich trägt europäische Maßnahmen und Initiativen zumeist mit, entwickelt jedoch nicht den Anspruch, diese auch zu beeinflussen. Was die Umsetzung betrifft, lässt Österreich oftmals zu wünschen übrig. Insbesondere im außen- und sicherheitspolitischen Bereich sollte die Republik dringend klären, was ihre strategischen Interessen und Ziele sind, die sie dann proaktiv im europäischen Rahmen vertreten sollte. Bislang erschöpft sich die österreichische Außenpolitik im Aktionismus und ist getrieben von innenpolitischen Überlegungen – als Folge davon werden Entscheidungen getroffen, die europäische Partner wie Rumänien vor den Kopf stoßen und die sachlich nicht gerechtfertigt sind. Kleinstaaten wie Österreich sind jedoch außen- und sicherheitspolitisch auf Allianzen oder Koalitionen angewiesen, was eine nachvollziehbare Positionierung in verschiedenen Bereichen unumgänglich machen würde.
Das gilt in ähnlicher Form auch für Europa. Sowohl Österreich als auch Europa sollten auf internationale Zusammenarbeit setzen, um drängende Probleme lösen oder zumindest deren Auswirkungen abmildern zu können. Als einer der wichtigsten politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Räume weltweit sollte die EU auch eine effiziente, verlässliche und proaktive Rolle spielen können.
Bundesstaat oder Staatenbund
Mit dieser Betrachtung gelangt man rasch zur eigentlichen Kernfrage: Wie können in Europa effiziente und demokratisch legitimierte Entscheidungen getroffen werden, die das Gemeinwohl im Sinn haben? Dass die aktuelle Struktur der EU unzureichend ist, erscheint immer offensichtlicher – aber die Kernfrage ist eine viel grundsätzlichere:
Sollte die EU ein supranationaler Staatenbund bleiben oder sich zu einem integrierten Bundesstaat weiterentwickeln? Muss also das Verhältnis zwischen den Mitgliedsstaaten und der Union komplett neu verhandelt und gestaltet werden?
Gerade außenpolitisch muss die EU demokratisch legitimierte Entscheidungen treffen können, die handelnden Personen von den Wähler:innen verantwortlich gehalten werden können. Die demokratische Legitimität ist zwar grundsätzlich gegeben, weist allerdings Verbesserungspotenzial auf. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass Ursula von der Leyen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament keine der Spitzenkandidat:innen war, anders als beispielsweise ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker. Bei einer echten bundesstaatlichen Struktur mit soliden demokratischen Grundsätzen würde sich diese Frage nicht stellen.
Gleichzeitig ist es auch möglich, das bestehende System zu verbessern, ohne den supranationalen Charakter der Union infrage zu stellen. Ein Beispiel hierfür wäre, das Einstimmigkeitsprinzip zugunsten einer qualifizierten Mehrheit aufzugeben und das außenpolitische Primat der Union zu überantworten – der Rat oder der Europäische Rat legt die außenpolitischen Parameter fest, die von allen europäischen Entscheidungsträger:innen mitzutragen sind. Nur so könnte in außenpolitischen Fragen der aktuell vorherrschenden strategischen Kakofonie entgegengewirkt werden.