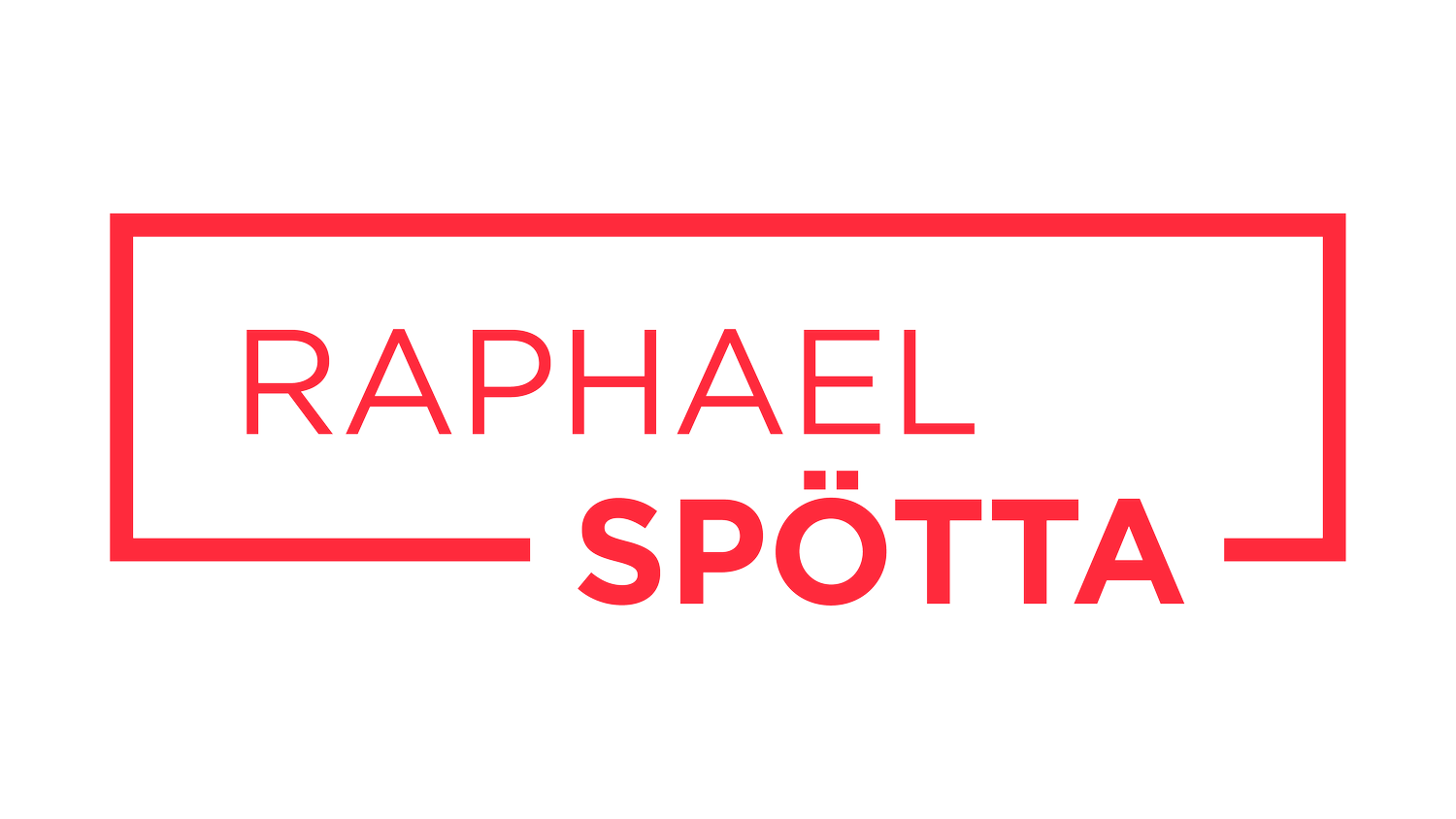Irak-Krieg: 20 Jahre danach
Invasion
Baghdad, am 20. März 2003. In den frühen Morgenstunden dieses Donnerstags wird die irakische Hauptstadt von Explosionen erschüttert, es fallen Schüsse. Die Szenerie ist von zahlreichen Bränden in orangerotes Licht getaucht. Die US-geführte Invasion im Irak hatte begonnen, und die irakischen Streitkräfte sollten die Übermacht der Truppenverbände dieser Koalition, bestehend aus USA, Großbritannien, Australien und Polen, spüren. Am Vorabend war ein Ultimatum des damaligen US-Präsidenten George W. Bush abgelaufen: Saddam Hussein sollte den Irak verlassen oder die USA würden eine Invasion des Landes beginnen.
Die Kampfhandlungen dauerten etwa drei Wochen, dann war das irakische Regime komplett zusammengebrochen. Koalitionskräfte hatten den Irak vollständig unter Kontrolle gebracht, zumindest schien es zunächst so. Zur Verwaltung des Irak etablierte man die Coalition Provisional Authority (CPA), die auf Basis der Resolution 1483 des UN-Sicherheitsrats operierte und vom US-amerikanischen Diplomaten Paul Bremer geleitet wurde. Nach dem Ende der Kampfhandlungen hielt Präsident Bush an Bord des US-Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln eine Rede: „Mission Accomplished“. Diese Worte sollten ihn noch verfolgen.
Kriegsgründe
Saddam Hussein, noch bis 1988 ein Verbündeter der USA gegen den Iran, war in relativ kurzer Zeit in Ungnade gefallen. Bis 1988 unterstützten die USA den Irak im Krieg gegen den Iran, doch als Saddam Hussein zwei Jahre später Kuwait annektierte, griffen die USA ein. 1991 befreite eine internationale Koalition Kuwait von der irakischen Besatzung, damals auf Basis eines Mandats des UN-Sicherheitsrats. Obwohl US-Truppen bereits Richtung Baghdad vorstießen, wurde letztendlich davon abgesehen, Saddam Hussein zu stürzen. Der Irak, der damals tatsächlich Massenvernichtungswaffen besaß und sogar ein Nuklearwaffenprogramm betrieb, wurde dazu gezwungen, diese Waffenprogramme zu beenden und bestehende Arsenale zu vernichten. Wie man heute weiß, hielt sich der Irak tatsächlich an die Vorgaben der UN.
Mehr noch: der Irak war 2003 weder technologisch noch ökonomisch dazu in der Lage, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln oder zu produzieren. Das wurde deutlich, als schlicht keine Massenvernichtungswaffen oder auch nur Anzeichen für entsprechende Programme gefunden wurden. Einer der Kriegsgründe war in sich zusammengefallen – und auch die anderen Argumente waren nicht stichhaltig. Dass der Irak Verbindungen zu al-Qaida unterhalten würde, war faktisch nicht korrekt. Tatsächlich waren die Anschläge vom 11. September 2001 sämtlich von saudischen Staatsbürgern ausgeübt worden. Andere Verbindungen zu terroristischen Organisationen waren, wenn, dann nur oberflächlich vorhanden. Letztlich blieb nur das Argument der Menschenrechtsverletzungen, die das Regime immerhin tatsächlich beging. Dass diese eine Intervention rechtfertigen würden, wurde allerdings von Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch bestritten.
Die US-Regierung unter George W. Bush hatte versucht, eine Drohkulisse aufzubauen, in deren Zentrum Saddam Hussein stand. Dessen Regime, das wurde mantraartig wiederholt, habe nicht nur Verbindungen mit al-Qaida oder anderen terroristischen Gruppen, sondern besäße Massenvernichtungswaffen und beginge Menschenrechtsverletzungen. Diese drei Argumente wurden immer wieder wiederholt: Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, Menschenrechtsverletzungen. Bereits 2003 wusste man jedoch, dass diese Argumente, auf denen die US-Regierung ihren Krieg aufbaute, nicht stichhaltig waren. Aber die Entscheidung war gefallen: Saddam Hussein musste gestürzt werden.
Zusammenbruch
Nach der Invasion war die irakische Armee besiegt, erhebliche Teile der irakischen Infrastruktur zerstört und auch die Sicherheitslage verschlechterte sich zusehends. Anstatt jedoch mit den irakischen Behörden zusammenzuarbeiten und gegen Plünderungen und Überfälle vorzugehen, beging die CPA einen entscheidenden Fehler, der den Grundstein für weitere Konflikte legte. Mit der Coalition Provisional Authority Order 2 wurde die irakische Armee sowie die Sicherheits- und nachrichtendienstliche Infrastruktur des Irak aufgelöst. Mit einem Schlag waren nicht nur 500.000 Menschen arbeitslos, von den Streitkräften war zudem die wirtschaftliche Existenz von über 5 Mio. Menschen abhängig. Hinzu kam, dass Millionen an Geldern für den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Irak in Korruptionskanälen versickerten; lediglich ein Bruchteil der Verträge für den Wiederaufbau wurden an irakische Firmen vergeben.
Es überrascht also nicht, dass sich lokale Milizen, oft nach religiöser Zugehörigkeit, bildeten, die einerseits für Sicherheit sorgen sollten und andererseits politischen Einfluss bedeuteten. Eine dieser Milizen war die sogenannte „Mahdi-Armee“ des schiitischen Geistlichen Muqtada as-Sadr. Diese Milizen waren auch Ausdruck einer beginnenden Konfessionalisierung, also der Spaltung der irakischen Bevölkerung entlang konfessioneller Bruchstellen. Saddam Hussein und die politische Elite des Irak waren Sunniten, die irakische Bevölkerungsmehrheit bestand jedoch aus Schiiten. Hinzu kam, dass Maßnahmen der CPA die Konfessionalisierung eher bestärkten als abmilderten. So wurde etwa der Iraqi Governing Council (IGC), also faktisch die Übergangsregierung des Irak, nach konfessionellen Gesichtspunkten besetzt. Das befeuerte die Spaltung nur noch weiter. Schiitische politische Führer begannen, Sunniten auszugrenzen und Sunniten sahen sich in der Befürchtung bestätigt, dass ihnen eine demokratische Ordnung zum Nachteil gereichen würde, waren sie immerhin in der Minderheit.
Die Sicherheitslage verschlechterte sich rapide und spätestens 2004 hatte ein ausgewachsener Aufstand begonnen. Ein sunnitischer Aufstand nahm seinen Ausgang in der Stadt Falluja, aus der sich US-Besatzungstruppen zurückziehen mussten. Gleichzeitig begann die Mahdi-Armee mit Offensivoperationen in Sadr City, Najaf, Kerbala, Kufa und Kut. Begann dieser Konflikt in erster Linie als Aufstand gegen die US-geführte Besatzung des Irak, wandelte er sich jedoch spätestens 2005 in einen ausgewachsenen konfessionellen Konflikt. Der Irak glitt zusehends in einen Bürgerkrieg ab. Auch die hastig in der US-Botschaft entworfene und schließlich verabschiedete Verfassung beförderte den Konflikt nur weiter.
Politische Krisen
Erst im Herbst 2007 begann sich die Sicherheitslage zu stabilisieren. Das hing vor allem mit einer massiven Aufstockung der US-Präsenz im Irak zusammen, gleichzeitig übten die Nachbarstaaten des Irak Druck auf ihren jeweiligen Einflussbereich aus, um Spillover-Effekte zu vermeiden. Außerdem traten Erschöpfungseffekte auf: die Konfliktparteien hatten Einflusszonen etabliert, auch durch sogenannte „ethnischen Säuberungen“, interne Machtkämpfe klangen ab und bestimmte Gruppen hatten sich schlichtweg mit Gewalt durchgesetzt. Die politischen Krisen im Irak endeten jedoch nicht mit der Stabilisierung der Sicherheitslage.
Vieles hing nach 2007 an der Person des Premierministers Nouri al-Maliki. Maliki, der sich gegen die Mahdi-Armee durchgesetzt hatte, agierte zusehends autoritärer, insbesondere nach dem Abzug der US-Truppen unter Präsident Obama im Jahr 2010. Hinzu kam der steigende Einfluss der Islamischen Republik Iran. Das löste weitere Konflikte, insbesondere mit der sunnitischen Bevölkerung aus, gegen die sich seine Politik zusehends richtete. Diese Politik, gepaart mit wirtschaftlicher Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit in der Provinz Anbar bildete den Nährboden für jihadistische Gruppen, insbesondere für den sogenannten „Islamischen Staat“, der zunächst als „al-Qaida im Irak“ und später als „Islamischer Staat im Irak“ auftrat. Die Krise um den „Islamischen Staat“ kostete Maliki 2014 das Amt.
20 Jahre später
Der Irak durchlebte in den vergangenen 20 Jahren verschiedenste politische Krisen. Erst vergangenes Jahr war es zu monatelangen Machtkämpfen zwischen Muqtada as-Sadr und seinen politischen Konkurrenten gekommen, die im Sommer auch in Gewalt umgeschlagen waren. Nachdem as-Sadr daraufhin dazu aufrief, die Gewalt zu beenden und seinen Rückzug aus der Politik ankündigte, kam es weiterhin zu gewaltsamen Ausschreitungen. Erst im Herbst 2022 konnte ein politischer Kompromiss erreicht werden und dem Irak gelang ein erster Schritt zur Überwindung des politischen Stillstands: die Bildung einer Regierung unter Premierminister Muhammad Shia al-Sudani. Zwischen 2019 und 2022 war es immer wieder zu Demonstrationen und Protesten aufgrund zahlreicher wirtschaftlicher und sozialer Probleme gekommen, der Irak scheiterte aufgrund des politischen Patts zudem immer wieder an der Bildung einer handlungsfähigen Regierung.
20 Jahre nach dem Beginn der US-Invasion im Irak ist offensichtlich: Nicht nur war die Invasion selbst klar völkerrechtswidrig, sie war löste außerdem eine Kette an Ereignissen aus, die die politische Lage und die Sicherheitslage im Irak selbst, aber auch in der Region destabilisierten. Unbeabsichtigte Folgen der Invasion waren zweifellos eine stark zunehmende Konfessionalisierung im Irak, ein nicht tragfähiges politisches System, der wachsende Einfluss des Iran auf die Politik im Irak, aber auch das Erstarken von extremistischen, jihadistischen Gruppen wie dem IS. Es erscheint offensichtlich, dass die damalige, neokonservative US-Regierung unter George W. Bush nicht wusste oder wahrhaben wollte, was ein Krieg gegen den Irak bedeutet, nämlich ein langfristiges, auch militärisches, Engagement. Immerhin: Auch heute noch befinden sich NATO-Truppen im Irak, die die irakischen Streitkräfte ausbilden.
Ein weiteres Spannungsfeld ist das Verhältnis zum Iran. Der Irak versucht einen Akt auf dem Drahtseil, indem er sowohl zu den USA als auch zum Iran gute diplomatische Beziehungen zu erhalten versucht. Inwieweit dies gelingen kann und wird, ist eine spekulative Frage – wie auch die Frage, ob sich der Irak in Zukunft nachhaltig stabilisieren kann. Als Ausgangspunkt der aktuellen politischen Krisen und Konflikte muss die völkerrechtswidrige Invasion der USA im Irak gesehen werden.