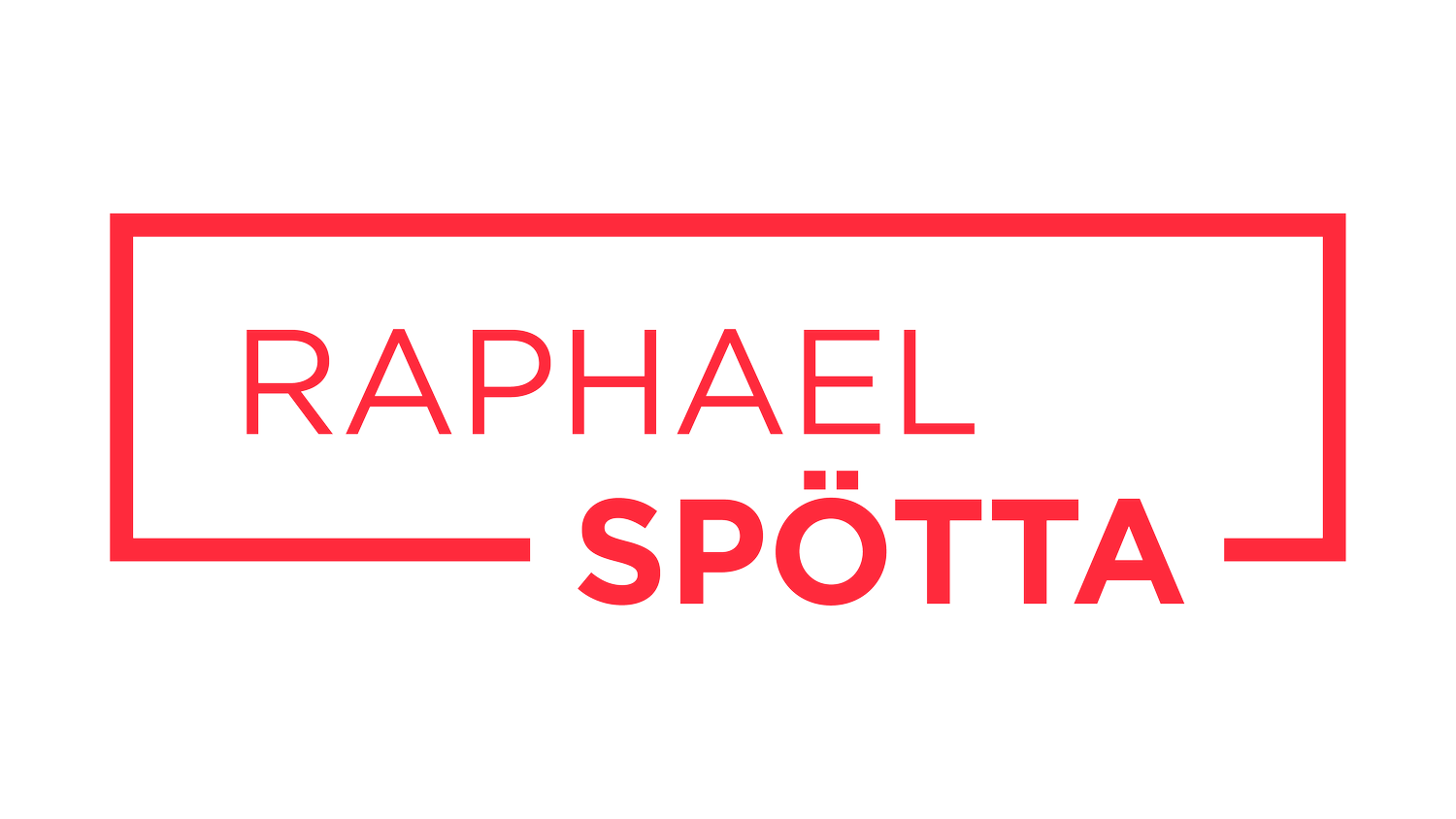Sturm auf das Kapitol überschattet Neustart
Zuerst hören sie Schreie. Glasscheiben zerbersten. Schüsse fallen. Männer in dunklen Anzügen bringen im Laufschritt den Vizepräsidenten Mike Pence in Sicherheit. Die Türen des Sitzungssaals, in dem beide Kammern des Kongresses getagt hatten, werden verbarrikadiert. Trotz allem gelingt es dem Mob, den Saal zu stürmen.
Erst Stunden später gelingt es den Polizeikräften der Capitol Police, das Kapitolgebäude zu räumen und einen Perimeter zu errichten. Die Bilanz des Tages: fünf Tote, darunter ein Polizist. Unter dem Vorsitz des Vizepräsidenten, gleichzeitig Senatspräsident, bestätigte der Kongress schließlich die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl vom 3. November 2020. Ein Akt der eigentlich eine reine Formalie hätte sein sollen.
Baghdad und Potomac
Heute erinnert ein schwer bewachter Bereich um das Kapitol an diesen schwarzen Tag der US-Demokratie, als ein amtierender Präsident eine gewaltbereite Menschenmasse auf den Sitz der Legislative hetzte. Rund um das Kapitol stehen nun Maschendrahtzäune, bewacht von der Nationalgarde und dem Secret Service – die „Capitol Green Zone“. Dass damit Assoziationen mit der Green Zone in Baghdad geweckt werden, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.
Und dennoch: ist es nicht ein Zeichen für die Stabilität der US-Demokratie, dass Joe Biden kommenden Mittwoch angelobt wird? Dass der Sturm auf das Kapitol und Donald Trumps zunehmend verzweifelte Versuche, seinem Demokratischen Herausforderer den Wahlsieg doch noch zu nehmen, letztlich gescheitert sind? Letztlich hat sich die US-Verfassung als stärker erwiesen als der (noch) amtierende Präsident.
Joe Bidens Angelobung als 46. Präsident der Vereinigten Staaten wird von diesen Ereignissen überschattet. Ebenso von den vier turbulenten Jahren Donald Trumps im Weißen Haus. Es gibt viel zu tun, viel zu reparieren für die Demokraten. Bidens Präsidentschaft ist ein dringend benötigter Neustart für die US-Politik. Sobald Obamas ehemaliger Vizepräsident am 20. Jänner 2021 den Amtseid ablegt, wird die wahrscheinlich bizarrste Episode der US-Geschichte ihr Ende gefunden haben.
Ende der Beziehungspause
Außenpolitisch werden die USA ihre internationalen Partnerschaften, insbesondere mit Europa, wiederbeleben müssen. Das internationale Engagement der USA steht spätestens seit dem Rückzug der US-Truppen aus Nordsyrien infrage; ebenso nährte Joe Bidens Amtsvorgänger Zweifel an der Unterstützung der USA für NATO-Partner. Das hat zu einer Diskussion darüber geführt, ob die Transatlantische Militärallianz überhaupt noch zeitgemäß ist.
Unter Joe Biden, der Jahrzehnte an außenpolitischer Erfahrung in das Amt mit einbringt, ist mit einem Ende dieser Beziehungspause und einem Wiedererstarken der Transatlantischen Beziehungen zu rechnen. Die tektonischen Bruchlinien bleiben aber bestehen. Der Handel zwischen Europa und China, die Debatte über die strategische Autonomie der Union und die Beziehungen der EU zu Russland sind potenzielle Probleme. Trump hat diese offen und rüpelhaft angesprochen. Biden wird sie anders thematisieren, aber thematisieren wird er sie.
Weitere Fragen stellen sich in Hinblick auf den Handelskrieg mit China und die Position der USA zu Russland. Die USA haben sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen, trotz der Jahrhundertherausforderung Klimawandel. Eine weitere Herausforderung ist die iranische Urananreicherung. Hier stellt sich die Frage, ob Joe Biden das Atomabkommen mit dem Iran (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) wieder in Kraft setzen kann und wird. Die Nervosität der Golfstaaten in Hinblick auf eine Entspannung mit dem Iran ist vorprogrammiert. Auch die Gespräche über eine nuklearwaffenfreie Koreanische Halbinsel gilt es, weiterzuführen, wenngleich Kim Jong-un keinen ganz so freundlichen Gesprächspartner im Weißen Haus erwarten darf wie zuletzt.
Hinzu kommen verschiedenste innen- wie auch außenpolitische Herausforderungen. Die oberste Priorität der neuen Administration wird der Kampf gegen die COVID-19-Pandemie haben. Das beinhaltet auch eine Form der Diplomatie, die man als “Impf-Diplomatie” bezeichnen könnte. Staaten, die keinen oder nur einen schlechten Zugang zu Vakzinen haben oder sich diesen nicht leisten können, werden zu einer außenpolitischen Priorität werden müssen.
Steter Tropfen
Dennoch: die strukturellen Probleme der Vereinigten Staaten werden auch unter einem Präsidenten Biden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gelöst werden. Nicht, weil er sie nicht lösen will, sondern weil er sie nicht lösen wird können. Die wachsende soziale Ungleichheit in den USA und die zunehmende Entfremdung von schwarzen und weißen Bevölkerungsschichten stellen mit die größten Herausforderungen dar.
Zu viel sollte man sich von Bidens Präsidentschaft also nicht erwarten, denn er steht vor Problemen, die während einer Präsidentschaft, geschweige denn in nur einer Amtszeit, nicht gelöst werden können. Donald Trumps Einfluss wird zudem weit über das Ende seiner Amtszeit hinausreichen, vor allem in Anbetracht seiner Ernennungen von drei Richtern zum Supreme Court. Er hat außerdem eine gewaltbereite Anhängerschaft hinterlassen – Ausschreitungen oder gar Anschläge sind nicht auszuschließen. Biden wird daher versuchen, eine möglichst breite Basis für seine Gesetzesvorhaben zu finden, um kein Öl ins Feuer zu gießen.
Das bedeutet, er ist auf die Republikaner im Senat angewiesen. Das umso mehr, da eine 50:50-Aufteilung im Senat und der „Tie-Break-Vote“ der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris für wichtige Gesetzesvorhaben nicht reichen wird. Erst mit einer Mehrheit von 60 Stimmen kann eine Debatte im Senat geschlossen werden – bis dahin können die Republikaner die Abstimmung über ein Gesetzesvorhaben theoretisch bis zum Ende der Legislaturperiode hinauszögern.
Trotz allem lässt sich feststellen: Joe Bidens nun beginnende Präsidentschaft ist ein dringend benötigtes Signal dafür, dass Logik und Rationalität in der Politik noch ihren Platz haben; dass Anstand und Würde immer noch zählen. Und auch, wenn die Biden-Administration nicht alle notwendigen Reformen durchbringen wird können, kann man erstmals wieder seit vier Jahren die Hoffnung schöpfen, dass die Zukunft eine bessere sein kann.
Bild: Shutterstock.com