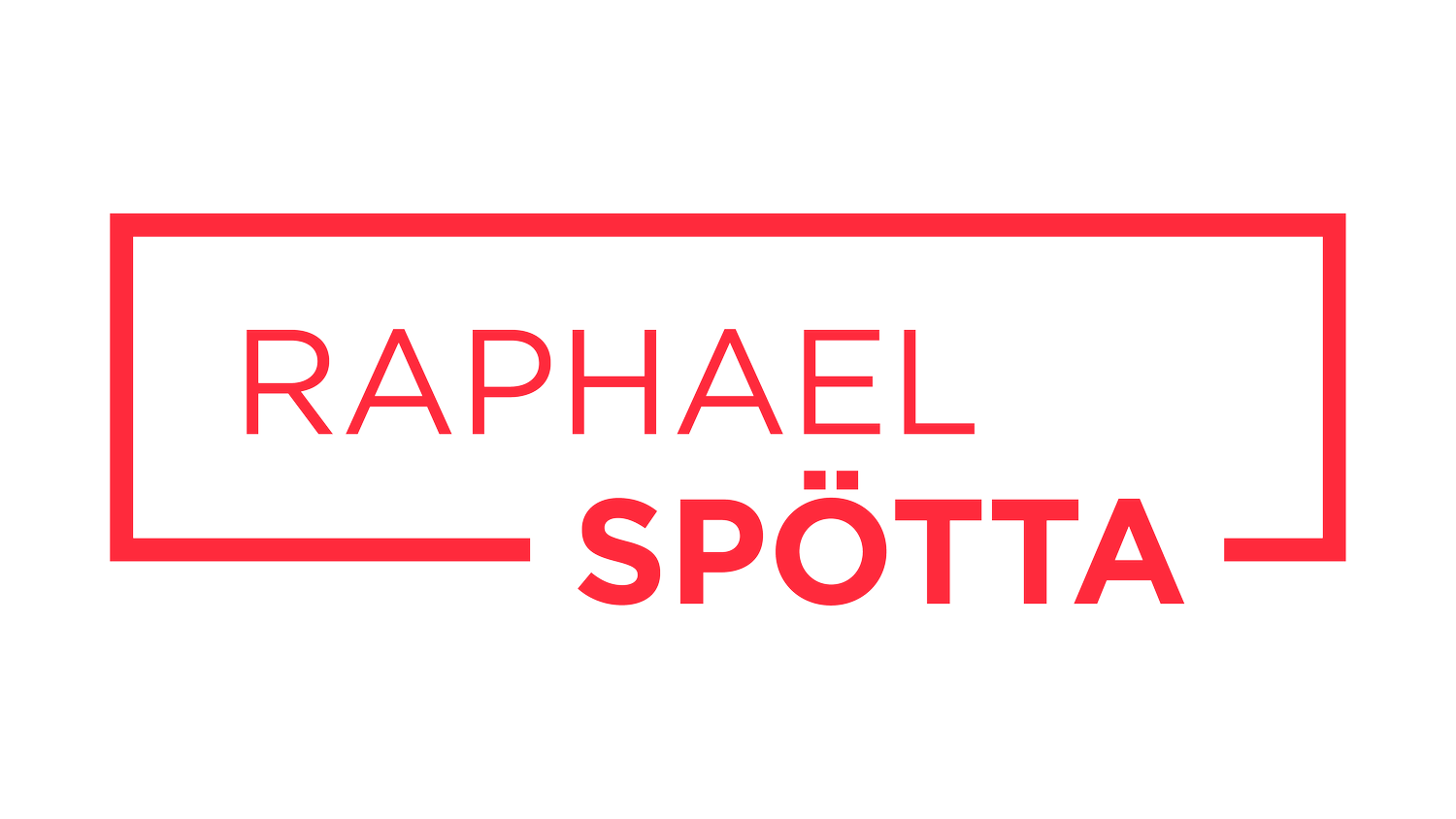Balanceakt in der Taiwanstraße
Taiwan habe einen „Sieg für die Gemeinschaft der Demokratien“ errungen, so Chang Lai-te am Abend seines Wahlsiegs. Der Präsidentschaftskandidat der chinakritischen Partei DPP wurde am 13. Jänner 2024 zum Präsidenten Taiwans gewählt. War eigentlich damit gerechnet worden, dass China seine militärischen Aktivitäten in der Taiwanstraße drastisch erhöhen würde, doch bislang blieb eine übermäßig aggressive Reaktion Beijings aus. Zwar überschritten chinesische Schiffe und Kampfflugzeuge die Medianlinie der Taiwanstraße und drangen damit in den von Taiwan kontrollierten Raum ein. Das erfolgte jedoch in deutlich geringerer Zahl als es bereits zuvor der Fall war. Auch die Haltung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping war auffallend zurückhaltend. Aktuell scheint die zwangsweise Wiedervereinigung mit militärischen Mitteln keine Option zu sein.
Diese auffallende Zurückhaltung liegt an mehreren Faktoren. Einerseits erklärte der gewählte Präsident, den Status quo nicht infrage stellen zu wollen – was faktisch bedeutet, dass eine taiwanesische Unabhängigkeit derzeit kein realistisches Szenario ist. Andererseits wäre eine militärische Eroberung der Insel Taiwan durch China äußerst risikoreich. Das liegt insbesondere an der US-Politik gegenüber Taiwan. Obwohl die USA Taiwan seit 1979 nicht mehr offiziell anerkennen und daher auch keine diplomatischen Beziehungen mehr mit Taipeh unterhalten, unterstützen sie Taiwan gewissermaßen inoffiziell. Zuletzt war diese Unterstützung sehr deutlich geworden, sie äußerte sich etwa anhand der Besuche von Kongressdelegationen, wie etwa jenem der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi im Jahr 2022. Dass die USA Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs unterstützen würden, lässt sich auch aus der westlichen Unterstützung der Ukraine im Zuge des russischen Angriffskriegs ableiten. China verfolgt diesen Konfliktverlauf sehr genau und leitet hieraus Reaktionsmuster des Westens für den Taiwan-Konflikt ab.
Fragiles Gleichgewicht
Das aktuelle politisch-strategische Gleichgewicht in der Taiwanstraße ist nichtsdestoweniger fragil. Dieses hängt davon ab, dass Taiwan nicht offiziell die Unabhängigkeit anstrebt, die USA diese Unabhängigkeit nicht fördern, Taiwan dazu in der Lage ist, China militärisch abzuschrecken und, dass China nicht versucht, Taiwan mit militärischen Mitteln zu erobern. Diese Faktoren stehen durch verschiedene Entwicklungslinien zunehmend infrage. Der Wahlsieg der DPP, die für eine Unabhängigkeit Taiwans eintrat, ist dabei ein wesentlicher Faktor. Ein anderer ist der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA im November 2024.
Die Unterstützung der Vereinigten Staaten für Taiwan ist ohnehin bereits ein Drahtseilakt. Ein zu hohes Ausmaß an Unterstützung, und es könnte als Unterstützung der Unabhängigkeit Taiwans ausgelegt werden. Ein zu geringes Maß an Unterstützung, und Taiwan wäre bei der Verteidigung gegen China wohl auf sich gestellt. Beide Fälle könnte China zum Anlass nehmen, seine Interessen auch mit militärischer Gewalt durchzusetzen.
Auftakt zu den US‑Präsidentschaftswahlen
Aktuell deutet alles darauf hin, dass die nächsten Präsidentschaftswahlen zu einem Rematch zwischen dem derzeitigen Amtsinhaber Joe Biden und seinem Vorgänger Donald Trump werden. Bidens Unterstützung für Taiwan ist offensichtlich, jedoch von der Unterstützung einer taiwanesischen Unabhängigkeit entfernt. Es ist nicht unmöglich, dass sich diese Unterstützung weiter intensiviert, was China wiederum zum Anlass nehmen könnte, zu versuchen, den Konflikt militärisch zu lösen. Das ist der Biden-Administration jedoch bekannt und folgerichtig unwahrscheinlich. Sollte hingegen Donald Trump einen Wahlsieg erringen, ist damit zu rechnen, dass dieser von einer Unterstützung Taiwans Abstand nimmt – zumindest suggerierte er das in einem Interview mit Fox News. Weiters besteht die Möglichkeit der weiteren Verschlechterung der US-chinesischen Beziehungen sowie eines neuerlich intensivierten Handelskriegs zwischen den USA und China. Das könnte Beijing aufgrund seiner derzeit angeschlagenen Wirtschaft zusätzlich unter Zugzwang setzen. Ein Konflikt könnte dadurch noch wahrscheinlicher werden – und noch wahrscheinlicher, durch einen erratischen Präsidenten im Weißen Haus.
Großmacht-Konflikt
Ein militärischer Konflikt hätte Folgen, die weit über die Konfliktregion selbst hinausgehen würden. Einerseits wäre die geografische Nähe zur japanischen Provinz Okinawa zu nennen, wo sich mehrere US-Militärstützpunkte befinden. Doch angesichts der Bedeutung Chinas für die globale Wirtschaft wären die ökonomischen Auswirkungen dramatisch.
Außerdem handelt es sich bei Taiwan um den relevantesten Hersteller von Halbleitern weltweit. Laut Angaben des Economist produziert Taiwan über 60 Prozent aller globalen Halbleiter und über 90 Prozent der fortschrittlichsten. Faktisch bedeutet das, dass Taiwan die globale Chip-Produktion unangefochten und quasi-monopolistisch kontrolliert. Zudem ist es eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Laut der WKO betrug das nominelle BIP Taiwans im Jahr 2023 748,2 Mrd. US-Dollar und liegt damit auf Platz 21 der größten Volkswirtschaften. Ein Konflikt hätte also bedeutende Auswirkungen auf die globale Wirtschaftslage.
Abwendbare Eskalation?
Eine Eskalation des Taiwan-Konflikts ist grundsätzlich nicht unausweichlich. Durch eine sich verschärfende Systemkonkurrenz zwischen den USA und China wird ein Konflikt zwischen diesen beiden Staaten wahrscheinlicher. Das erfordert im Taiwan-Konflikt aktives Konfliktmanagement und nach Möglichkeit die Beibehaltung des Status quo, der von allen Konfliktparteien grundsätzlich akzeptiert wird. Klar ist, dass es sich dabei um keine nachhaltige Konfliktlösung handelt, deren Notwendigkeit grundsätzlich evident ist. Die Beibehaltung des Status quo erscheint aktuell jedoch als das erreichbare Maximum.