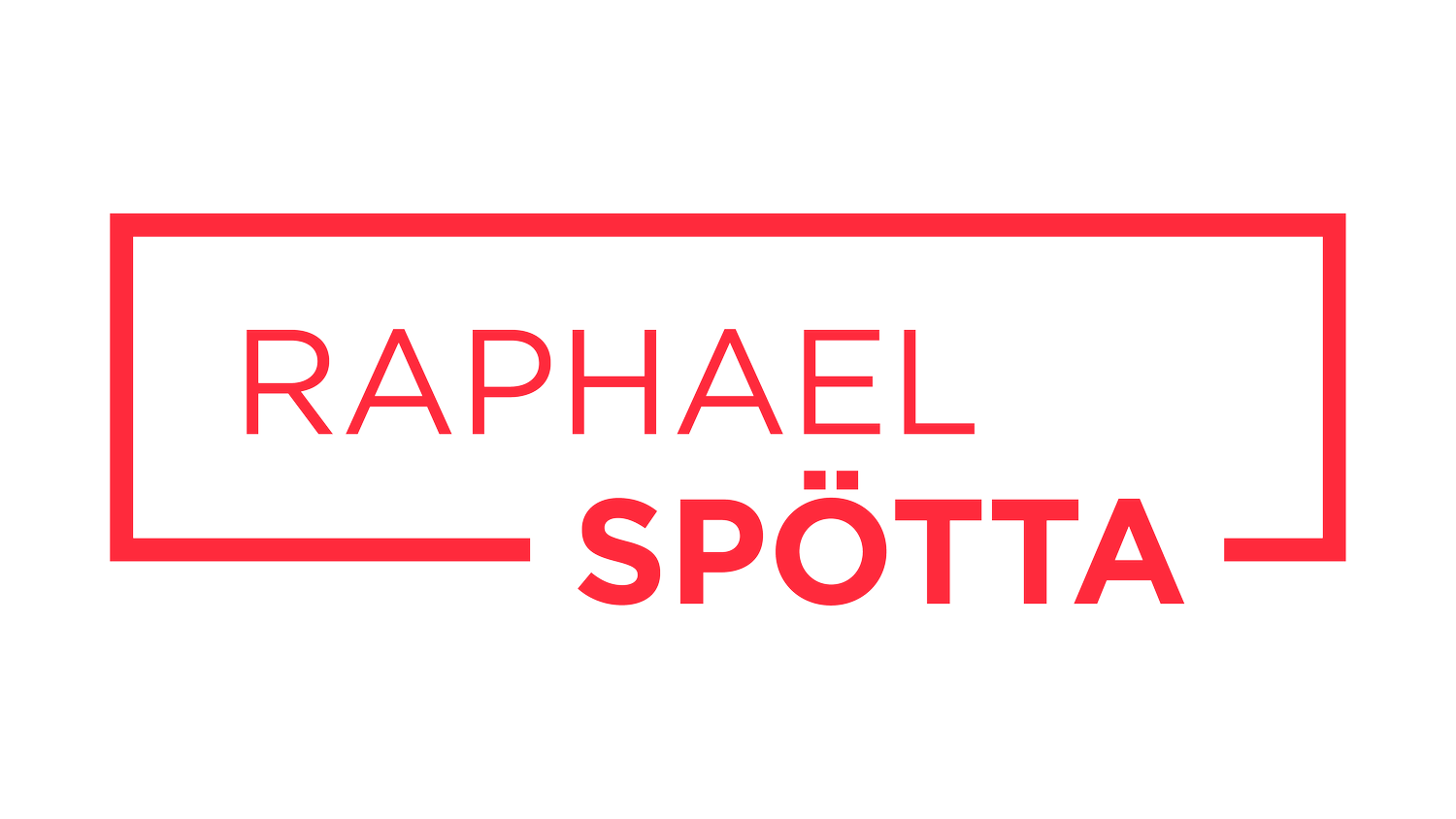Transatlantische Zerreißprobe
„In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want“. Bei einer Rede in South Carolina ließ Donald Trump wissen, dass er sich als Präsident nicht an die Beistandsverpflichtungen gemäß Artikel 5 des Nordatlantikvertrags, Gründungsdokument der NATO und tragende Säule der transatlantischen Sicherheitsarchitektur, halten werde, sofern die Verteidigungsausgaben der Alliierten nicht hoch genug ausfallen. Im Gegenteil werde er Russland „dazu ermutigen, zu tun, was zur Hölle sie auch immer tun wollen“. Mit einem Mal stand die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Zentrum des US-Wahlkampfs – unfreiwillig, jedoch nicht unerwartet. Joe Biden bezeichnete diese Äußerungen gar als „dumm“, „beschämend“ und „gefährlich“.
Erodierendes Vertrauen
Donald Trump unterminiert mit derartigen Äußerungen das Vertrauen in die transatlantische Partnerschaft und damit in die europäische Verteidigung. Die europäischen NATO-Mitglieder, das ist kein Geheimnis, verlassen sich stark auf die Unterstützung durch die Vereinigten Staaten. So hat etwa die Bedeutung der NATO spätestens seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 2022 wieder stark zugenommen. Das Beitrittsgesuch Schwedens und Finnlands, die Ausarbeitung des Strategischen Konzepts und nicht zuletzt die nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands unterstreichen die zentrale Bedeutung der NATO für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der europäischen Staaten.
Die NATO basiert nicht zuletzt auf der Zusicherung, dass alle Mitgliedsstaaten im Falle eines militärischen Angriffs auf einen von ihnen Unterstützung leisten. Das ist letztlich mehr eine politische als eine rechtliche Frage. Bestehen Zweifel daran, dass die USA sich an ihre Sicherheitsgarantie gegenüber Europa halten würde, wird das Vertrauen in die NATO-Beistandsklausel unterminiert. Damit wird die Glaubwürdigkeit der Allianz und ihre Abschreckungsfähigkeit infrage gestellt. Behauptet also Donald Trump nun, er werde Russland als US-Präsident frei gewähren lassen und Moskau sogar dazu ermutigen, NATO-Mitglieder auch militärisch anzugreifen, stellt das die gesamte transatlantische Sicherheitsarchitektur infrage und die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik vor eine veritable Krise.
Burden Sharing
Der Hintergrund dieser Aussage Trumps ist das sogenannte „Burden Sharing“, also die gleichmäßige Lastenverteilung der Verteidigungsbemühungen zwischen den USA und den europäischen Partnern. Die Forderung, Europa müsse mehr für seine Verteidigung tun, erheben die USA bereits seit Jahrzehnten. Im Jahr 2014 einigten sich die NATO-Verteidigungsminister darauf, zwei Prozent ihres jeweiligen BIP für den Verteidigungshaushalt aufzuwenden. Dabei handelt es sich um ein politisches Ziel, das von den meisten NATO-Mitgliedern lange nicht eingehalten wurde. In diesem Jahr werden voraussichtlich 18 von 31 NATO-Mitgliedstaaten, also knapp 60 Prozent der Mitgliedsstaaten, das Zwei-Prozent-Ziel erfüllen. Das gab NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg letzte Woche bekannt.
Für die USA handelt es sich beim Zwei-Prozent-Ziel um den wesentlichsten Indikator für das Burden Sharing, weswegen sich die Debatte auch stets um die Verteidigungsausgaben drehte. Grundsätzlich ist eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben zur Beseitigung des massiven Investitionsstaus, unter dem auch das Österreichische Bundesheer lange Zeit gelitten hatte, ein notwendiger und legitimer Schritt. Damit ist allerdings noch nicht sichergestellt, dass diese finanziellen Mittel auch in die richtigen Kanäle fließen, also beispielsweise in die Fähigkeitenentwicklung. So bedarf es beispielsweiser recht hoher finanzieller Mittel, um den Investitionsstau der deutschen Bundeswehr zu beheben – beschafft werden Kleidung, Kampfhelme, Rucksäcke oder Nachtsichtgeräte sowie Munition. Das bedeutet noch keine Investitionen in Fähigkeiten oder Kapazitäten. Relevanter als das Erreichen von genau zwei Prozent des BIP für Verteidigungsausgaben ist das Beheben von Investitionsstaus, wo vorhanden, und die Sicherstellung einer Planbarkeit für die jeweiligen nationalen Streitkräfte.
Dabei lässt eine allzu intensive Fokussierung auf das Burden Sharing sowie das Zwei-Prozent-Ziel den Umstand außer acht, dass Donald Trump nicht einfach die hierzu seit Jahrzehnten bestehende Position der USA vertritt. Vielmehr ist Trump selbst kaum paktfähig und scheint sich seit seiner Wahlniederlage im Jahr 2020 noch weiter radikalisiert zu haben. Trumps Führungsstil wurde zunehmend als erratisch und irrational beschrieben. Es kann also nicht als sicher angenommen werden, dass Trump nicht aus einer Laune heraus erneut die NATO oder ihr Schutzversprechen infrage stellt. So analysierte etwa auch Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München im Podcast „Politikteil“ vom 16. Februar 2024, dass Trump einfach nicht verstünde, „was Allianzen sind“.
Die GSVP im Fokus
Die Aussicht auf eine weitere Amtszeit Donald Trumps rückt die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der Europäischen Union wieder stärker in den Fokus. Seit Beginn der Präsidentschaft Joe Bidens hat deren Bedeutung im Vergleich zu jener der NATO abgenommen. Immerhin: Mit einem US‑Präsidenten, der die transatlantische Partnerschaft nicht infrage stellt, konnte man sich der Unterstützung Washingtons wieder sicher sein. Hinzu kam die wachsende Bedeutung der NATO mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, dem Beitritt Finnlands und dem nach wie vor offenen Beitrittsgesuch Schwedens. Trotz des Beitritts Dänemarks zur GSVP erschien deren Relevanz zu stagnieren bzw. abzunehmen.
Dies würde jedoch die Bedeutung und vor allem die Rolle der Europäischen Union im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterschätzen. Es war nie das Ziel, dass die EU und die GSVP als Ersatz für die NATO dienen sollten, das unterstreichen nahezu alle Erklärungen und Strategiedokumente. Betont wird stets, dass die NATO der primäre sicherheits- und verteidigungspolitische Handlungsrahmen der europäischen Mitgliedsstaaten bleibe. Die GSVP kann auch als Stärkung der europäischen Säule der NATO verstanden werden. Durch verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen der GSVP verbessert sich auch die Interoperabilität der EU-Mitgliedsstaaten untereinander, durch gemeinsame Beschaffungsvorgänge schafft man Synergien und gemeinsame Übungen fördern die verteidigungspolitische Integration. Eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedsstaaten kommt auch der NATO zugute, einen Ersatz für die Nordatlantik-Allianz bietet die Europäische Union allerdings nicht.
Russland wartet nicht ab
Das bedeutet aber auch, dass die NATO derzeit die einzige wirksame militärische Abschreckung gegenüber Russland darstellt. Dass sowohl die USA als auch Europa sich auf eine russische Aggression vorbereiten ist unerlässlich, denn diese russische Aggression ist längst im Gange. Seine Invasion der Ukraine 2022, sein erster Angriff auf die Ostukraine, seine Annexion der Krim 2014 sowie sein Angriff auf Georgien 2008 zeigen, dass Moskau vor militärischer Gewalt nicht zurückschreckt. Steht die Glaubwürdigkeit des NATO-Schutzversprechens infrage, bedroht Russland potenziell Finnland, Schweden, Estland, Lettland, Litauen und Polen.
Russland wendet allerdings ebenso subkonventionelle Mittel zur Interessensdurchsetzung an – Pro-Kreml-Propaganda, prorussische Bots und Trolle und die mittlerweile von der EU gesperrten „Nachrichtenoutlets“ Sputnik und RT gehören ebenso dazu wie der Missbrauch von Rohstoffen zur Erpressung Europas. Russische Einflussoperationen reichen mittlerweile weit über Osteuropa hinaus. Beispielhaft zu nennen ist hier das Interview des ehemaligen Fox-News-Moderator und Verschwörungstheoretiker Tucker Carlson mit Vladimir Putin. Dieses Interview zielt auf die Beeinflussung eines Republikanischen, Pro-Trump-Publikums. So behauptete Putin im Zuge dieses Interviews, Russland habe kein Interesse daran, Polen oder Lettland anzugreifen – einer Aussage bar jeglicher Glaubwürdigkeit, denn Putin behauptete dasselbe von der Ukraine. All diese Aktivitäten sind Elemente der hybriden Kriegsführung Russlands gegenüber dem Westen.
Lehren für Europa
Die Bedeutung des Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl ist zentral für Europa, das ist offensichtlich. Die europäische Sicherheit basiert auf einer Arbeitsteilung zwischen der EU und der NATO. Die EU hat in diesem Gefüge die Rolle übernommen, Krisenmanagement zu betreiben und hat das Potenzial, hybride Aktivitäten verschiedener Akteure – nicht zuletzt Russlands – zu identifizieren und wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Verliert die militärische Bündnisverteidigung durch die NATO an Glaubwürdigkeit oder erodiert ihre Bedeutung, bricht eine wesentliche Säule der transatlantischen Sicherheitsarchitektur zusammen. Sowohl die EU als auch die NATO sind für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik unabdingbar. Seit 2016 hätte Europa die eigenen Verteidigungsfähigkeiten und damit auch die europäische Säule der NATO stärken können und müssen. Sollte Trump sowohl Republikanischer Präsidentschaftskandidat als auch ins Weiße Haus gewählt werden, das muss Europa sofort realisieren, steht potenziell die Glaubwürdigkeit der NATO infrage. Damit bleibt nur noch wenig Zeit, sich auf eine derart verheerende Entwicklung bestmöglich vorzubereiten.
Beitragsbild: Joseph Sohm/Shutterstock