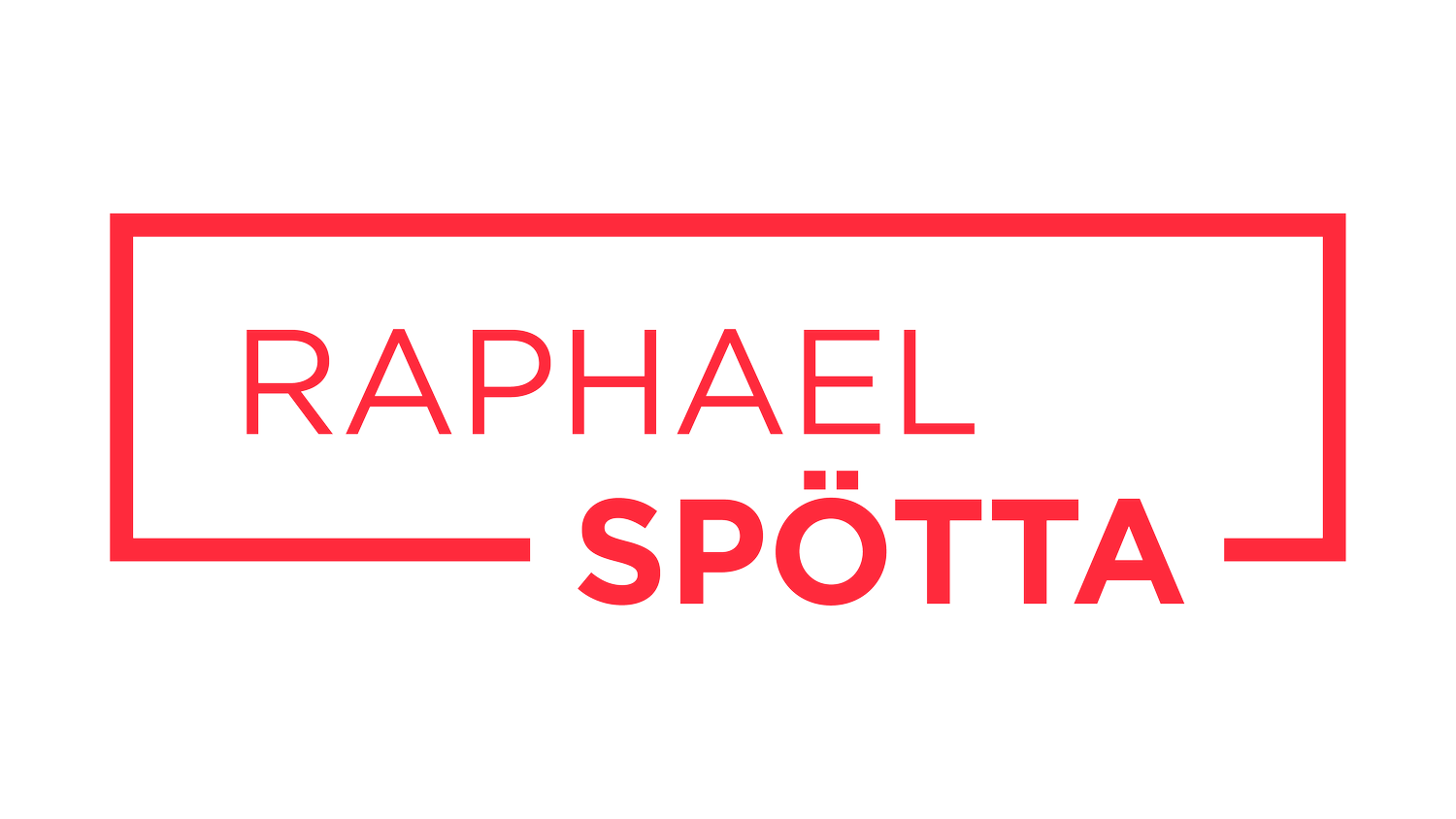Die Echos von Nagorno-Karabach
Der seit Jahrzehnten bestehende Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die armenische Enklave Nagorno-Karabach scheint ein abruptes Ende gefunden zu haben. In lediglich zwei Tagen eroberte Aserbaidschan die Region, deren Behörden erklärten offiziell ihre Auflösung mit 1. Jänner 2024. Laut Angaben der armenischen Regierung flohen über 100.000 Personen aus Nagorno-Karabach nach Armenien, bei einer Gesamtbevölkerung der Enklave von etwa 120.000 Menschen.
Humanitäre Krise
Armenien zeigt sich zwar hilfsbereit, stößt jedoch auf die schiere Anzahl der Flüchtlinge auf massive finanzielle Probleme. Mit einem BIP pro Kopf von lediglich knapp über 8.000 US-Dollar und einem Staatshaushalt von gerade einmal 6,4 Mio. US-Dollar kann Armenien die Grundversorgung der Geflüchteten nicht in ausreichender Höhe garantieren. Selbst, wenn die Geflohenen es schaffen, sich eine neue Existenz in Armenien aufzubauen, stellt die Flucht und der Verlust ihrer Heimatregion ein massives Trauma dar, das sie und auch Armenien voraussichtlich prägen wird.
Verschiebung der Konfliktdynamik
Mit dem militärischen Erfolg Aserbaidschans geht eine Verschiebung der Konfliktdynamik einher. Wenngleich es so wirken mag, als hätte Aserbaidschan einen seit Jahrzehnten bestehenden Konflikt in lediglich zwei Tagen beendet, haben diese Ereignisse doch weitaus komplexere regionalpolitische, aber auch geopolitische Folgen.
So wurde überdeutlich, dass Russland als traditioneller Verbündeter Armeniens entweder über nicht ausreichend Kapazitäten verfügt, um Armenien zu unterstützen, oder es ihm an Interesse mangelt. Vor dem Hintergrund seines fortgesetzten Angriffskriegs gegen die Ukraine, der die Ressourcen und die Aufmerksamkeit Moskaus bindet, erscheinen beide Varianten durchaus plausibel. Das muss in Erevan jedoch unzweifelhaft die Frage zur Folge haben, ob seine Beziehungen zu Moskau und die armenische Mitgliedschaft in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (CSTO) tatsächlich Armeniens Sicherheit zuträglich sind. Immerhin erhielt man weder 2020 noch 2023 ausreichend Unterstützung gegen Aserbaidschan.
Regionalpolitische Waghalsigkeit?
Die Frage, wie es um die Relevanz Russlands als Ordnungsmacht am Kaukasus bestellt sein mag, könnte relevanter sein, als vermutet. Dass mit dem aserbaidschanischen Sieg gegen Nagorno-Karabach auch der Konflikt beendet und damit Stabilität in der Region Einzug gehalten hätte, ist eine trügerische Einschätzung. Zwar hat der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev einen für ihn wichtigen Sieg errungen, doch verrät ein Blick auf die Landkarte, dass ein Teil des aserbaidschanischen Territoriums eine durch armenisches Gebiet abgetrennte Exklave bildet: Nachitschewan. Dass Armenien in offiziellen aserbaidschanischen Dokumenten auch als „West-Aserbaidschan“ bezeichnet wird und man in Baku offensichtlich der Überzeugung ist, dass Armenien auf eigentlich aserbaidschanischem Territorium errichtet wurde, bietet genügend Anlass zur Sorge.
Hinzu kommt, dass Armenien nicht über die militärischen Fähigkeiten und Kapazitäten verfügt, einen weiteren Angriff Aserbaidschans abzuwehren. Dass die Kriege 2020 und 2023 für Aserbaidschan so erfolgreich verliefen, wirft die Frage auf, ob es nicht versucht ist, eine territoriale Passage zu seiner Exklave Nachitschewan zu schaffen – mit militärischer Gewalt. Krieg erscheint als Mittel der Politik aufgrund des scheinbaren Erfolgs attraktiver.
Europäische Perspektive
Dies läuft jedoch den (widersprüchlichen) Interessen der Europäischen Union in der Region zuwider. Aserbaidschan stellt einen wichtigen Energielieferanten für die EU dar. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die Sicherung von nicht-russischen Energieträgern Priorität. Folgerichtig unterzeichnete die EU ein Abkommen mit Aserbaidschan, das die Verdoppelung der Gasimporte und die Stärkung nachhaltiger Energieimporte vorsieht. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete Aserbaidschan gar als „zuverlässigen Energielieferanten“.
Gleichzeitig vertritt Europa den Anspruch, dem internationalen Recht zur Geltung zu verhelfen, was sowohl die territoriale Integrität von Staaten, die Einhaltung der Menschenrechte, als auch die Gewaltlosigkeit in den internationalen Beziehungen betrifft. Sofern Aserbaidschan weiter aggressiv gegen Armenien vorgeht, steckt die EU erneut in einer Zwickmühle zwischen ihren legitimen energiepolitischen Interessen und ihrem idealistischen Anspruch an die internationalen Beziehungen.
Stabilität der Region
Europa ist also in erster Linie an einem stabilen Kaukasus interessiert. Allzu offensiv betreiben kann es jedoch eine solche Stabilitätspolitik jedoch nicht. Eine militärische Mission in dieser Region wäre vielleicht sinnvoll, um Aserbaidschan von weiteren Übergriffen auf armenisches Territorium abzuhalten, allerdings könnten sich sowohl Russland als auch der Iran durch eine solche Mission einer Bedrohung ausgesetzt sehen. Eine zivile Mission hingegen vermag Aserbaidschan nicht von weiteren Militäraktionen abhalten.
Europas Vorgehensweise muss also in erster Linie Unterstützung für Armenien beinhalten. Das betrifft einerseits Wirtschaftshilfe und finanzielle Hilfe bei der Versorgung der Flüchtlinge aus Nagorno-Karabach. Andererseits sollte die Union darauf abzielen, eine strategische Balance zwischen Armenien und Aserbaidschan herzustellen, um Armenien so weit zu stärken, dass es den militärischen Vorteil Aserbaidschans auszugleichen imstande ist. Das darf jedoch nicht so weit gehen, Armenien selbst die Möglichkeit zu einer militärischen Offensive zu geben.
Die weitere Verwaltung des Gebiets Nagorno-Karabach stellt den Gegenstand diplomatischer Gespräche dar. Weder eine Rückgabe noch eine Rückeroberung durch Armenien erscheinen wahrscheinlich. Am ehesten vorstellbar ist eine diplomatische Lösung, die festgeschriebene Minderheitenrechte beinhaltet, im Abtausch gegen freien Waren- und Personenverkehr durch den Sangesur-Korridor, der Nachitschewan und das aserbaidschanische Hauptterritorium über armenisches Staatsgebiet verbindet. Dies kann jedoch nur dann gelingen, wenn die EU Armeniens Verhandlungsposition soweit stärkt, dass Aserbaidschan nicht mehr versucht ist, seine Interessen mit militärischen Mitteln durchzusetzen.