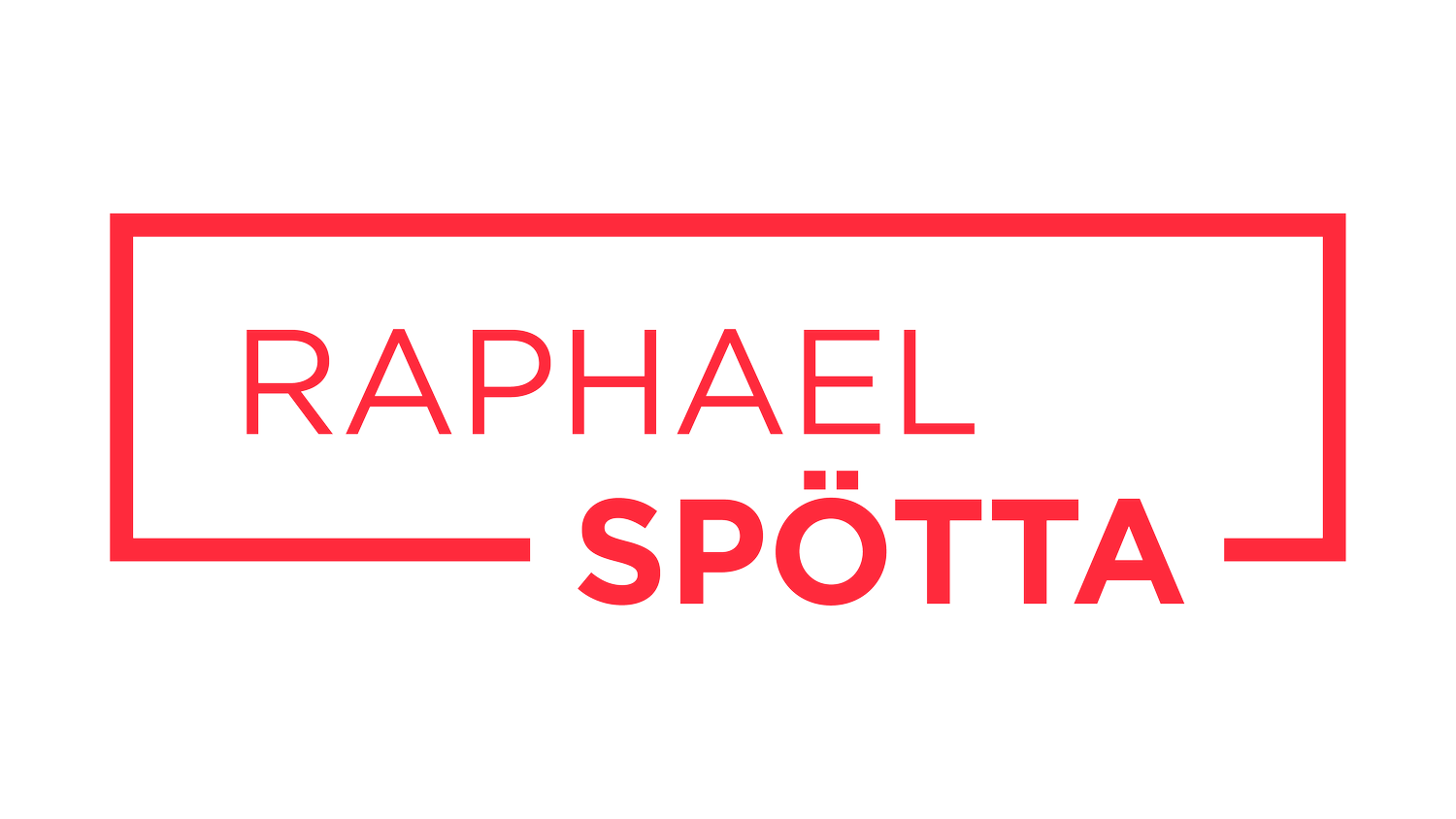Sechs Monate Krieg in der Ukraine
Kriegsverlauf
Mitte Februar 2022 lief die europäische Diplomatie auf Hochtouren. Die meisten politischen Beobachter:innen spekulierten darüber, ob Russlands Präsident Vladimir Putin einen Angriff auf die Ukraine befehlen würde oder nicht. Handelte es sich beim massiven russischen Truppenaufgebot lediglich um eine Drohgebärde oder um den Auftakt zu einer Invasion? Tatsächlich erschien es unwahrscheinlich, dass Putin tatsächlich einen Angriff auf die Ukraine befehlen könnte. Immerhin: die Kosten eines solchen Angriffes wären enorm, sowohl Europa als auch die USA müssten mit massiven Wirtschaftssanktionen reagieren und außerdem hätte Russland im Vergleich zu den Kosten eines solchen Krieges nur wenig zu gewinnen.
Kurz: Die Wenigsten waren wirklich davon überzeugt, dass Russland eine massive militärische Eskalation wollte. Viel eher schien es, als würde Russland versuchen, die USA und Europa an den Verhandlungstisch zwingen zu wollen. Dafür sprachen die Forderung nach den russischen „Sicherheitsgarantien“, die im Dezember 2021 veröffentlicht worden waren. Selbst in der Ukraine glaubte man damals nicht an eine russische Invasion. Der ukrainische Präsident Selenskyi warnte gar vor „Panikmache“ durch die USA.
Anfang 2022 schien es noch, als könnte man Russland davon überzeugen, von seinen Kriegsbestrebungen abzulassen. Es sei immerhin verständlich, dass man sich gegen eine vermeintliche weitere Expansion der NATO absichern wolle – solche oder ähnliche Einschätzungen waren damals oftmals zu hören. Wenngleich Russland legitime Sicherheitsinteressen haben mochte, mit dem 21. Februar wurde überdeutlich, worauf die Massierung von Truppen an der ukrainischen Ostgrenze tatsächlich hinauslief und welche Interessen Vladimir Putin tatsächlich verfolgte.
Anerkennung der "Volksrepubliken"
Am 21. Februar 2022 erklärte Putin per Dekret die Anerkennung der „Volksrepubliken“ Donetsk und Luhansk durch Russland. In einer etwa eine Stunde langen Fernsehansprache sprach er zudem der Ukraine die Staatlichkeit ab und kündigte an, dass russische Truppen in den Donbas vorrücken würden. Russland wurde für diesen völkerrechtswidrigen Vorstoß massiv kritisiert und weitere Wirtschaftssanktionen wurden angekündigt.
Invasion
Putin ließ es dabei bekanntermaßen jedoch nicht bewenden. Am 24. Februar 2022, genau vor sechs Monaten, begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Vor sechs Monaten musste man befürchten, dass die Ukraine kaum ein paar Wochen durchhalten würde. Die russische Übermacht und die Fähigkeiten und Kapazitäten der russischen Streitkräfte seien zu überwältigend. Allerdings machten ebenjene, vermeintlich überlegenen, russischen Streitkräfte einen schwerwiegenden taktischen Fehler nach dem anderen.
Versuchte Einnahme Kyjiws
Zu Beginn der Invasion erklärte Russland die „Demilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ der Ukraine zum Ziel des Angriffskrieges, der von russischer Seite als „Spezialoperation“ bezeichnet wird. Beobachter:innen verstanden darunter sowohl eine militärische Kapitulation (bzw. Auflösung) der ukrainischen Streitkräfte sowie einen Regimewechsel. Während des 24. Februar 2022 begann Russland auf dem gesamten ukrainischen Staatsgebiet mit militärischen Operationen, darunter auch eine Luftlandeoperation beim Flughafen Kyjiw-Hostomel. Explosionen ereigneten sich unter anderem bei Kramatorsk, Mariupol, Odesa, Kyjiw, Dnipro, Saporischschja und Charkiw. Zudem führte die russische Schwarzmeer-Flotte Landungsoperationen im Asow’schen Meer und bei Odesa durch.
Russland versuchte in dieser Anfangsphase des Kriegs, die ukrainische Hauptstadt möglichst rasch einzunehmen. Offenbar hatten die russischen Streitkräfte nicht mit derart vehementem Widerstand der ukrainischen Kräfte gerechnet. Dem ukrainischen Militär gelang im Gegenteil die Verzögerung des russischen Vormarsches auf die Hauptstadt und es gelang den russischen Luftstreitkräften nicht, die Lufthoheit über die Ukraine zu erringen. Darüber hinaus hatte Russland mit verschiedenen Problemen zu kämpfen, die seine Logistik massiv beeinträchtigten und es machte in Zusammenhang mit der Logistik taktische Fehler. Beispielhaft zu nennen ist hier der über 60 Kilometer lange russische Konvoi, der sich Anfang März auf Kyjiw zubewegte und so zu einem verlockenden Ziel für die ukrainischen Streitkräfte wurde. Letzten Endes gelang es Russland nicht, Kyjiw einzunehmen und kündigte am 29. März seinen Rückzug an.
Mutmaßliche Kriegsverbrechen
Seit dem 24. Februar wird immer wieder von mustmaßlichen russischen Kriegsverbrechen berichtet. Am bekanntesten dürfte das Massaker von Butscha sein, bei dem über 400 ukrainische Zivilisten gezielt hingerichtet worden sein dürften. Andere Vorfälle sind beispielsweise der russische Raketenangriff auf den mit etwa 4.000 Zivilist:innen überfüllten Bahnhof der Stadt Kramatorsk oder die Bombardierung eines Kinderspitals oder des Theaters in Mariupol, in dem über 1.000 Zivilist:innen Schutz gesucht hatten.
Konzentration auf den Donbas
Seit April 2022 konzentriert sich Russland auf die Ostukraine. Während die seit Beginn des Konflikts 2014 bestehende Kontaktlinie von der Ukraine grundsätzlich gehalten und die Großstadt Charkiw erfolgreich verteidigt werden konnte, erzielte Russland kleinere Geländegewinne im Osten des Landes. Nach langer Belagerung konnte Russland Mariupol einnehmen und bis auf den Oblast Odesa alle Gebiete im Süden der Ukraine einnehmen, deren Kontrolle zur Schaffung einer Landbrücke zur Krim erforderlich ist. Durch die Rückeroberung der Schlangeninsel durch die Ukraine und die Versenkung des Schlachtschiffes „Moskwa“ Mitte April konnte die Ukraine das russische Vorgehen weiter verlangsamen.
Abnützungskrieg
Im Juli und August ergaben sich bis dato keine größeren Gebietsänderungen mit Ausnahme der Einnahme der Stadt Lysytschansk, der letzten größeren Stadt unter Kontrolle der Ukraine im Donbas. Anfang August starteten die russischen Streitkräfte eine neue Großoffensive in der Region Donetsk. Auch die Städte Nikopol in unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja und Mykolajiw wurden angegriffen. Das AKW Saporischschja ist (neben der Ruine des AKW Chernobyl) bereits zum wiederholten Male in den Schlagzeilen, da es von Russland immer wieder unter Beschuss genommen wurde. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) sieht derzeit allerdings keine unmittelbare Bedrohung.
Der Krieg in der Ukraine scheint spätestens mit Juli 2022 in eine neue Phase eingetreten zu sein: die des Abnützungskriegs. Ein längerfristig andauernder militärischer Konflikt kann grundsätzlich leicht zu einem solchen werden. Wird der Materialaufwand immer höher und die eingesetzten Soldat:innen immer stärker belastet, so hält das keine Streitmacht auf Dauer durch. Deswegen ist auch die Logistik für einen militärischen Erfolg essenziell: der Nachschub an militärischem Material und Einsatzkräften ist von Beginn an erforderlich, geschweige denn nach einigen Monaten. Umso wichtiger ist die Moral der eingesetzten Truppen: für die ukrainischen Verteidiger:innen geht es um die Verteidigung der Heimat, der Familie und des eigenen Lebens, während in vielen Fällen russische Soldat:innen nicht einmal wussten, dass sie in einen Kriegseinsatz und nicht in einen Übungseinsatz in Belarus geschickt werden.
Bedeutung des Kriegs
Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete wenige Tage nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine diesen Angriff als „Zeitenwende“. Sechs Monate nach Beginn der Invasion ist die Frage, ob Analysen von damals noch halten und inwiefern sich diese „Zeitenwende“ auf die internationale Lage ausgewirkt hat.
Erneuter Kalter Krieg
Das russische Vorgehen in der Ukraine, das kalkulierte Andeuten Putins, Russland könne in der Ukraine auch Atomwaffen einsetzen, Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist ein Zivilisationsbruch, wie es ihn in Europa seit den Jugoslawien-Zerfallskriegen in 1990er Jahren nicht mehr gegeben hat. Es musste von Beginn an klar gewesen sein, dass die Europäische Union sowohl als wertebasierte als auch als rechtsstaatliche Gemeinschaft auf ein derartiges Vorgehen Russlands reagieren würde. Es dürfte für die meisten Beobachter:innen jedoch überraschend gewesen sein, wie rasch Europa tatsächlich reagiert hat. Binnen weniger Tage wurden Sanktionspakete gegen Russland geschnürt, die in ihrer Tragweite durchaus beachtlich waren. Dazu gehörte etwa auch der Beschluss, dass Russland vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden wurde.
Seither befinden sich die USA und auch die EU in einem erneuten Kalten Krieg mit Russland. Vereinzelt mögen Beobachter:innen geneigt sein, diesem „Kalten Krieg“ zu attestieren, dass er vermeintlich bereits ausgebrochen sei und „heiß“ geführt werde, nämlich in der Ukraine. Faktisch ist die aktuelle Situation jedoch mit jener während des ursprünglichen Kalten Kriegs durchaus vergleichbar. Auch damals wurden Stellvertreterkonflikte in Drittstaaten ausgetragen – zu nennen sind hier etwa der Koreakrieg (1950–1953), der Vietnamkrieg (1964–1975) oder der Krieg in Afghanistan (1979–1989). Gekennzeichnet waren diese Konflikte dadurch, dass die Konfliktparteien von den Supermächten mehr oder weniger direkt unterstützt wurden, mitunter griffen diese auch selbst in den Konflikt ein. Aber weder die USA noch die Sowjetunion führten miteinander einen „heißen“ Krieg.
Dieses Wiederaufleben der Logik des Kalten Kriegs und das Ende der optimistischen Weltsicht, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa Einzug gehalten hatte, wirkt sich auf viele verschiedene Bereiche aus. Die wirtschaftlichen Verflechtungen der 1990er und 2000er Jahre zwischen Europa und Russland können, im Gegensatz zur Zeit des Kalten Kriegs, mittlerweile als Waffen genutzt werden. So versucht Russland, die Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas zu nutzen, um sich scheinbar vor den Sanktionen zu „immunisieren“. Dies mit zweifelhaftem Erfolg, denn anders, als russische Propaganda es glauben machen möchte, fügen die westlichen Sanktionen der russischen Wirtschaft schweren Schaden zu. Dieses Element der russischen Propaganda bzw. der Desinformation, die vor allem über Soziale Medien verbreitet wird, ist ein weiteres Element, das den aktuellen Konflikt vom Kalten Krieg der 1950er bis 1980er Jahre unterscheidet.
Wirkungsketten
Doch ein wesentliches Element, das beide „Kalten Kriege“ gemeinsam haben, ist, dass sich dieser Konflikt zwischen zwei oder mehr Großmächten auch wesentlich auf andere Bereiche der internationalen Politik auswirkt. Um der jeweils anderen Seite Schaden welcher Art auch immer zuzufügen, werden auch Mittel verwendet, die mit „traditioneller“ Kriegsführung nichts oder nur wenig zu tun haben. Wirtschaftssanktionen, Desinformationskampagnen, Regimewechsel in Drittstaaten, oder die Drohung, Staaten bewusst zu destabilisieren – all das sind Elemente dieses erneuten Kalten Kriegs mit Russland.
Besonders relevant ist die potenzielle Destabilisierung von Drittstaaten. Als der Krieg in der Ukraine begann, mutmaßten die meisten Beobachter:innen, das aufgrund der Auswirkungen, die dieser Konflikt haben würde, wie etwa Flüchtlingsströme in Europa oder das Ausbleiben von Nahrungsmittellieferungen im Nahen Osten und Nordafrika, destabilisierende Effekte haben würde. Diese würden von Russland entweder erzeugt oder zumindest billigend in Kauf genommen.
Beschrieben werden kann das auch mit dem Begriff der „Wirkungskette“. Eine Wirkungskette ist ein Ereignis oder ein Ablauf von Ereignissen, das kausal andere Ereignisse bedingt, die wiederum andere Ereignisse bedingen – wie eine Kette. Kurz gesagt: Ereignis A führt zu B, B führt zu C und C führt zu D. Würde also Russland Getreidelieferungen aus der Ukraine an den Libanon unterbinden, würde das die Getreidepreise im wirtschaftlich ohnehin angeschlagenen Libanon hochtreiben. Das würde dafür sorgen, dass das Potenzial an Protesten und gewaltsamen Ausschreitungen steigt. Diese Wirkungsketten dürfen jedoch nicht isoliert voneinander betrachtet werden: So unterhalten etwa die UN eine Mission im Libanon, UNIFIL, die je nach Mandat zur Stabilität des Landes beiträgt. Das hängt jedoch von Russland ab, einerseits, was die Mandatsgestaltung betrifft, andererseits, ob das Mandat überhaupt bestehen bleibt. Da es regelmäßig vom UN-Sicherheitsrat erneuert werden muss, bietet sich Russland eine Gelegenheit, die USA und die europäischen Staaten unter Druck zu setzen, indem man mit dem Veto droht. Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf die genannte Wirkungskette.
Fähigkeiten und Kapazitäten Russlands
Nach den Ereignissen der 1990er Jahre und den für Russland im militärischen Bereich ungünstigen Entwicklungen, insbesondere der erste Tschetschenienkrieg (1994–1996) durchliefen die russischen Streitkräfte einen profunden Entwicklungs- und Transformationsprozess. Nach weitreichenden Reformversuchen unter dem damaligen Verteidigungsminister Serdjukow, einer teilweisen Neukonzipierung unter dem aktuellen Verteidigungsminister Schoigu und einer ersten intensiven Bewährungsprobe in Syrien (ab 2015) wurden die russischen Streitkräfte als durchaus schlagkräftig und gut ausgebildet beurteilt.
Die Bemühungen, das Militär zu modernisieren, neu auszurüsten und zu reformieren, führten zu Streitkräften, die heute kleiner, besser ausgestattet und besser ausgebildet sind und die auf einem höheren Stand der Einsatzbereitschaft gehalten werden als ihre sowjetischen Vorgänger.
James Hackett: Die Modernisierung der russischen Streitkräfte, 2021
Davon kann aktuell keine Rede mehr sein. Die russischen Truppen haben beim Einsatz in der Ukraine zu viele taktische Fehler gemacht. Ursprünglich hatte man auch nicht vermutet, dass sich die Ukraine derart lange gegen ein modernes Heer behaupten würde können. Die russischen Fortschritte und der Stand der russischen Streitkräfte stehen nun infrage. Mit dem Krieg in der Ukraine wurden taktische und operative Schwächen, insbesondere im Bereich der Logistik, aufgedeckt. Auch die russischen Verluste häufen sich – nach einer Schätzung der USA (also keine unabhängige Quelle!) belaufen sich diese auf etwa 80.000 Soldat:innen.
Gleichzeitig wurde offensichtlich, dass Russland von einer etablierten Strategie des minimalen Mitteleinsatzes bei maximalem Output abgerückt ist. Diese Strategie kam in verschiedenen Fällen zur Anwendung: in Syrien 2015, der Ukraine 2014 und Georgien 2008. Mit begrenztem Mitteleinsatz, also in diesen Fällen eine Militäroperation mit begrenztem Ziel sollte ein Maximum an Wirkung erzielt werden. Im Fall Syriens sollte der Machthaber Assad stabilisiert werden, im Fall der Ukraine und Georgiens reichte die Annexion eines Teilgebiets bzw. die Befeuerung eines (separatistischen) Konflikts, um eine weitere Westintegration dieser beiden Staaten erfolgreich zu unterbinden. Bei der Ukraine geschah dies 2014 auf der Krim und im Donbas, im Fall Georgiens 2008 mit Südossetien und Abkhasien. In beiden Fällen war eine weitere Integration in die EU oder gar die NATO vom Tisch, keine der beiden Organisationen möchte einen Mitgliedsstaat aufnehmen, der ungelöste territoriale Konflikte hat, noch dazu mit Russland.
Lektion für Europa
Für Europa ist das russische Vorgehen im Allgemeinen, insbesondere aber auch im Fall der Krim eine schmerzhafte Lektion in Sachen aggressiver Geopolitik. Der Grundgedanke der Europäischen Union ist zweifellos jener, mit wirtschaftlicher Verschränkung und politischer Kooperation sowie mittels Abtretung von Souveränitätsrechten einen faktischen Frieden zwischen Staaten zu schaffen. Das ist sowohl Vor- als auch Nachteil: ein Frieden im Sinne der Europäischen Union funktioniert dann, wenn Staaten sich der Rechtsordnung der Union unterwerfen und Mitglied werden wollen. Dann findet eine wirtschaftliche Integration in verschiedenen Bereichen und mittlerweile auch eine politische Integration statt. Die EU wird also zu einem Gebilde, das auch osteuropäische Mitgliedsstaaten aufgenommen, sich also „nach Osten ausgedehnt“ hat. Die Union ist offensichtlich nicht darauf vorbereitet, wenn Staaten wie Russland diese Vorstöße als unfreundliches Eindringen in die eigene Einflusssphäre werten. Gleichzeitig ist die EU in ihrer jetzigen Form auch ein Gebilde der 1990er Jahre. Das bedeutet, sie ist nicht oder nur schlecht auf eine geopolitische Auseinandersetzung mit einer Großmacht vorbereitet. Die EU kennt keine andere Friedensdurchsetzung als die ihre, nicht-militärische. Im Sinne einer geopolitischen Arbeitsteilung wäre das die Aufgabe der NATO, nicht der EU. Mit militärischen oder sicherheitspolitischen Mitteln auf Bedrohungen zu reagieren, sich im Notfall selbst verteidigen zu können oder gegebenenfalls einen potenziellen Gegner abzuschrecken, darauf ist die EU nicht vorbereitet und wahrscheinlich wäre sie auch gar nicht bereit, das zu leisten. Das ist insofern problematisch, als solche Großmächte keine Rücksicht darauf nehmen, ob die Union auf eine Konfrontation mit ihnen vorbereitet ist oder nicht.
Strukturelle Vorbereitung
Die Europäische Union muss sich und ihre Strukturen also auf einen solchen Ernstfall vorbereiten. Die Grundvoraussetzung hierfür ist politischer Wille, die EU auf eine solche Rolle vorzubereiten und möglichst rasche außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen treffen zu können. Dazu ist jedoch unerlässlich, dass die EU-Mitgliedsstaaten die Union auch als primären Handlungsrahmen für ihre jeweiligen Außen- und Sicherheitspolitiken begreifen. Es ist einer ambitionierten Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) bzw. der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) abträglich, wenn sich größere Mitgliedsstaaten de facto aussuchen können, ob sie sich nun im Rahmen der EU oder aber der NATO, der OSZE, oder der UN oder doch lieber gleich bilateral engagieren möchten. Dass hierfür eine vereinfachte Entscheidungsfindung und damit ein Abrücken vom Einstimmigkeitsprinzip erforderlich ist, ist evident.
Darüber hinaus sind zwei weitere Aspekte von strategischer Relevanz: einerseits benötigt die EU eine eigene Aufklärungskapazität. Im Falle des Truppenaufbaus Russlands um den Jahreswechsel 2021/22 wurde dies sehr deutlich. Die USA stellten ihre nachrichtendienstlichen Erkenntnisse einer Weltöffentlichkeit zur Verfügung und warnten davor, dass Russland die Ukraine angreifen würde. Wie auch in vielen anderen Bereichen muss jedoch auch hier die Frage gestellt werden, ob die Union sich die Abhängigkeit von den USA auch im nachrichtendienstlichen Bereich leisten kann oder will. Sofern sie das nicht will, braucht sie einen eigenen, vollwertigen Nachrichtendienst.
Bereits jetzt gibt es mit der Single Intelligence Analysis Capacity (SIAC) erste Schritte in diese Richtung, diese fokussieren allerdings in erster Linie auf den Austausch von nachrichtendienstlichen Informationen durch die Mitgliedsstaaten. Die Union muss hingegen dazu in der Lage sein, selbstständig Informationen zu sammeln, diese auszuwerten, zu analysieren und dann entsprechend zu handeln.
Nach diesen eigenen europäischen nachrichtendienstlichen Informationen zu handeln kann mitunter militärisches Eingreifen erfordern, etwa auf Basis einer Mission mit UN-Mandat, zum Zwecke einer Trainingsmission oder auch auf Einladung eines Gaststaats. Auch hier gibt es wiederum einen ersten Ansatz: mit den EU-Battlegroups bzw. der Rapid Deployment Capacity aus dem Strategischen Kompass soll die EU über eine sogenannte First Entry Force verfügen – das reicht jedoch aufgrund der künftigen Herausforderungen nicht aus. Der EU fehlt es maßgeblich an unabhängigen Fähigkeiten zum langfristigen Missionserhalt. Hierfür müsste die EU jedoch Kapazitäten im Logistikbereich aufbauen und, je nach Missionsprofil, auch entsprechende Fähigkeiten entwickeln.
Investitionsstau beseitigen
Gleichzeitig sind auch die europäischen Mitgliedsstaaten gefordert. Allzu oft, besonders auffällig ist dies in Deutschland und Österreich, wurde auf Investitionen in Streitkräfte verzichtet und so die Handlungsfähigkeit etwa der Bundeswehr oder des Bundesheeres infrage gestellt. Angesichts der Notwendigkeit, sich in Europa auch auf eine potenzielle weitere Eskalation vorzubereiten, nicht nur des Kriegs in der Ukraine. Die Ukraine ist lediglich einer von vielen globalen Hotspots, wo sich überall krisenhafte Entwicklungen ergeben können. Das betrifft womöglich etwa Südosteuropa, den Nahen Osten, Nordafrika, Sub-Sahara-Afrika, Zentral- und Ostasien oder auch andere Staaten in Osteuropa. Es ist unumgänglich, so bald wie möglich wieder militärische Handlungsfähigkeit herzustellen – auch auf Ebene der EU-Mitgliedsstaaten.
Längerer Hebel?
Doch die EU steht vor weiteren, akuten Herausforderungen. Aktuell ist zumindest in Österreich der Konsens für die Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Russland ins Wanken geraten. Die Unterstützung für die Ukraine ist auch nicht mehr völlig unumstritten und angesichts eines potenziell kalten Winters und steigender Energiepreise und die daraus resultierende Inflation steht zu befürchten, dass verschiedene EU-Mitgliedsstaaten versucht sein könnten, die Sanktionen zumindest infrage zu stellen. In Österreich fordern etwa der oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer sowie der Tiroler ÖVP-Parteiobmann Mattle eine „Evaluierung“ der Sanktionen, während FPÖ-Chef Herbert Kickl gar eine Volksabstimmung über die Sanktionen fordert. Ohne auf die Rechtmäßigkeit einzelner Forderungen im EU-Recht einzugehen, zeigt dies doch ein Bild, wonach die Sanktionen nicht mehr völlig unumstritten sind.
Dabei ist die Frage, wie lange die Sanktionen durchgehalten werden, auch eine danach, wer den längeren Atem hat. Die russische Wirtschaft trägt schweren Schaden durch die Sanktionen davon. Informationen dahingehend, dass diese Sanktionen ohnehin nichts brächten, sind daher falsch, und zum Teil auch von Russland selbst in Umlauf gebracht. Letzten Endes sind diese Sanktionen auch eine Frage nach der europäischen Identität und dem Zweck der europäischen Außenpolitik. Wenn Europa tatsächlich für eine regel- und normenbasierte Außenpolitik steht, dann kann es einen derart eklatanten Verstoß gegen das völkerrechtlich verankerte Allgemeine Gewaltverbot nicht hinnehmen, nur weil in der Vergangenheit Entscheidungen im Energiesektor getroffen wurden, die sich im Nachhinein als fatal herausgestellt haben, da sie Europa in eine energiepolitische Abhängigkeit von Russland geführt haben. Diese aufzubrechen ist eigentlich ein langfristiges Projekt, das nunmehr beschleunigt werden muss.
Ausblick
Der mit dem 24. Februar 2022 begonnene Krieg Russlands gegen die Ukraine berührt enorm viele Teilbereiche der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Er hat einige Mängel in der internationalen Handlungsfähigkeit der Europäischen Union aufgezeigt und je länger er andauert, umso risikoreicher wird er. Auch das Risiko eines Einsatzes von Atomwaffen durch Russland ist nach wie vor vorhanden, auch wenn Russland diese strategischen Waffen bisher vor allem dazu nutzt, um sich selbst gegen verschiedene Konsequenzen sowie ein Eingreifen der USA bzw. der NATO in der Ukraine zu verhindern.
Heute, am 24. August 2022, ist ukrainischer Unabhängigkeitstag. Heute dauert der Krieg, von dem die meisten dachten, er sei in wenigen Wochen vorüber, sechs Monate. Die Ukraine hält sich nach wie vor, der Krieg Russlands wurde zum Abnützungskrieg. Gerechnet haben nur sehr, sehr wenige mit einem solchen Vorgehen Russlands. Das zeigt, dass auch mit strategischen Überraschungen zunehmend zu rechnen ist. Europa muss sich auf solche Szenarien vorbereiten, auch, wenn wir das nicht wollen. Sich auf einen Konflikt einzustellen bzw. vorzubereiten, ohne zu wissen, ob dieser kommen wird und vor dem Hintergrund, dass man lieber einen jeden Konflikt vermeiden möchte, ist nicht einfach. Aber es ist die Aufgabe eines Staates. Angesichts der Herausforderungen, denen sich europäische Staaten gegenübersehen und angesichts des Umstands, dass europäische Staaten diese Aufgaben alleine kaum bewältigen werden können, ist es auch eine Aufgabe der Europäischen Union.
Eine der unmittelbarsten Herausforderungen ist zudem die Unterstützung der Ukraine. Europa ist hier gefordert. Als Gemeinschaft, die eine regelbasierte Weltordnung propagiert, kann Europa es nicht zulassen, dass die Ukraine im Stich gelassen und von Russland militärisch besiegt wird.
Wie sich der Konflikt in der Ukraine entwickeln wird und wie er ausgehen wird, ist nicht seriös zu beantworten. Aktuell wirkt es so, als würde sich Russland vor allem auf den Osten der Ukraine konzentrieren. Gelingt es den russischen Streitkräften, dieses Gebiet zu erobern, sind möglicherweise Verhandlungen über einen Waffenstillstand denkbar. Ob dieses Szenario eintritt, kann nur die Zeit zeigen.
Neuordnung Europas?
Angesichts russischer Gräueltaten in der Ukraine mag es verfrüht wirken, an eine neue europäische Sicherheitsarchitektur zu denken. Es mag sogar wie eine Missachtung der Ukraine und der Opfer, die sie zu ihrer Verteidigung bringt, erscheinen. Das Gegenteil ist der Fall. Russland hat mit dem Angriff auf die Ukraine ganz klar einen Zivilisationsbruch begangen, einfach so zum status quo ante zurückzukehren ist nicht möglich und sollte es auch nicht sein. Aber eine Tatsache bleibt unbestritten: Russland ist ein Nachbar Europas. Es ist nicht möglich, eine tragfähige europäische Sicherheitsarchitektur zu schaffen, ohne Russland zu inkludieren. Diesen Fehler hatte man bereits in den 1990er Jahren gemacht, und die heutige Situation gewissermaßen vorweggenommen.
Klar muss sein: Russland darf den aktuellen Krieg nicht gewinnen, aber es darf auch nicht derart verlieren, sodass wiederum der Grundstein für einen künftigen Konflikt gelegt wird. Im Gegenteil, eine inklusive Sicherheitsarchitektur muss auch Russland mit einschließen. Es kann nicht das aktuelle Russland unter der Präsidentschaft Putins sein, noch kann es ein Russland sein, dessen Soldat:innen bzw. Befehlshaber:innen sich gegebenenfalls für Kriegsverbrechen verantworten mussten. Aber es muss Russland grundsätzlich in eine neue, eine künftige europäische Sicherheitsarchitektur eingebunden sein. Das sollten wir in Europa immer im Hinterkopf behalten, wenn wir Politik in Richtung Moskau gestalten.