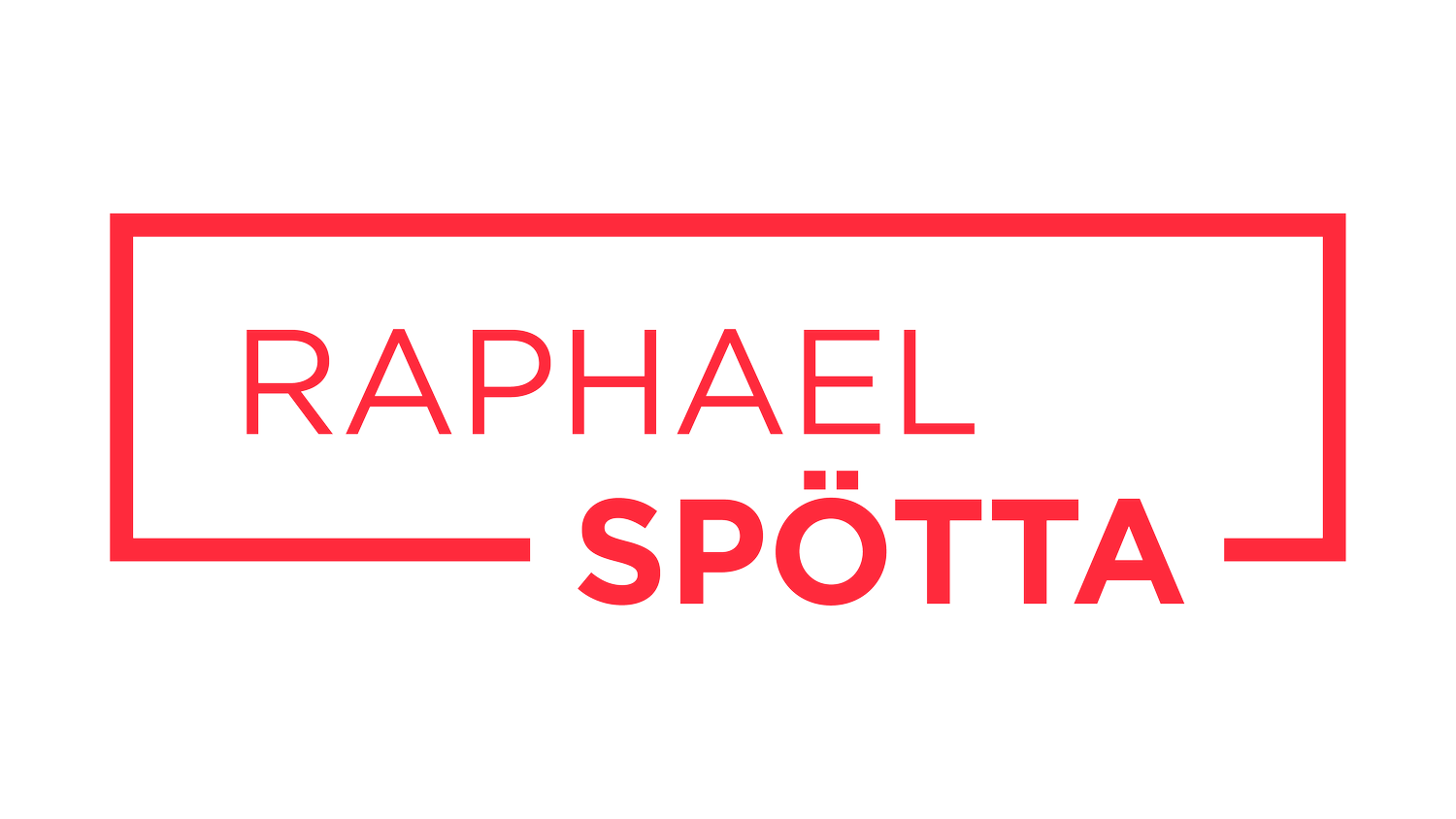Ein Ende mit Schrecken
Der letzte US-Soldat, der Afghanistan verließ, war Major General Christopher Donahue. Am 30. August, mitten in der Nacht, betrat General Donahue ein Transportflugzeug vom Typ C-17 „Globemaster“ am Hamid Karzai International Airport. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass der HKIA ausgerechnet nach dem ersten Präsidenten Afghanistans nach 2001 benannt wurde, denn Karzai steht wie kaum ein anderer für die weit verbreitete Korruption im Land.
Mit der Abreise von General Donahue war der vollständige Abzug aller US-Kräfte in Afghanistan vollzogen. Nach fast 20 Jahren hat der Einsatz der Vereinigten Staaten in Afghanistan ein denkbar unrühmliches Ende gefunden. Sowie die USA damit begonnen hatten, sich vom Hindukusch zurückzuziehen, gingen die Taliban in die Offensive und verbuchten extrem rasch gigantische territoriale Gewinne. Die Islamisten übernahmen nahezu gewaltlos Provinzhauptstadt um Provinzhauptstadt, besetzten Grenzposten und brachten schrittweise alle Gebiete Afghanistans unter ihre Kontrolle. Am 13. August rückten die Taliban auf die Hauptstadt Kabul vor – noch bevor sich die internationale Gemeinschaft vollständig aus Afghanistan zurückgezogen hatte.
Ein Ende mit Schrecken
In sozialen Netzwerken geistert seit einigen Jahren ein Bonmot herum, das um die US-Invasion 2001 aufgekommen sein dürfte. Afghanistan sei der „Friedhof der Imperien“. Vor über einem Jahr, als die USA mit den Taiban verhandelten, habe ich es als „Frankensteins Land“ bezeichnet. Es ist ein Land, in dem sowohl der Kampf ums Überleben als auch um Macht an der Tagesordnung steht. Ein Land, in dem trotz aller Bemühungen um Nation Building und des Kampfs gegen die Taliban einfach kein moderner Staat entsteht und die Islamisten weiterhin ein Machtfaktor bleiben.
Das war vor einem Jahr. Seither waren die Taliban auf dem Vormarsch. In nur zehn Tagen ist es ihnen gelungen, 20 Jahre der Bemühungen um ein stabiles Afghanistan zunichte zu machen. Man sagt, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Joe Biden entschied sich für das Ende mit Schrecken. Doch die USA werden nicht diejenigen sein, die die Konsequenzen tragen werden. Vielmehr sind es die Afghan:innen, die jetzt unter den Taliban werden leben müssen, die in eine ungewisse Zukunft gehen, von ihren vermeintlichen Verbündeten zurückgelassen.
Was sollte Europa tun?
Der Rückzug aus Afghanistan ist nicht das erste Beispiel dafür, dass die USA in erster Linie ihre Interessen vertreten und die Europäer:innen mit den Konsequenzen konfrontiert sind. Ein rezentes Beispiel hierfür ist der US-Rückzug aus Nordsyrien, der eine Invasion der Türkei ermöglicht und damit wahrscheinlich den Krieg verlängert hat. Derartige Gelegenheiten werfen immer wieder die Frage auf, ob und inwiefern Europa in die Fußstapfen der USA treten kann und soll, um europäische Interessen zu schützen.
Das Stichwort in diesem Zusammenhang ist Strategische Autonomie. Die EU solle unabhängig von den transatlantischen Partnern handlungsfähig werden, um nachhaltige, umsichtige und sachlich-fundierte Sicherheitspolitik zu machen. Das hätte im Fall Afghanistans bedeutet, dass Europa die Stabilisierung des Landes übernimmt, bis eine Verhandlungslösung mit den Taliban für eine inklusive, stabile und tatsächlich demokratische Staatsordnung erreicht worden ist. Es muss das Ziel sein, dass Europa die Möglichkeit hat, eine solche Entscheidung unabhängig von den USA zu treffen und umzusetzen.
Kartenhaus
Stattdessen fiel die internationale Mission nach der Ankündigung des Weißen Hauses, sich bis spätestens dem 11. September 2021 zurückziehen zu wollen, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das Resultat: Afghan:innen, die verzweifelt versuchen, sich an abhebenden Militärtransportern festzuklammern und nach bereits wenigen Sekunden in den Tod stürzen. Menschen, die vergebens darauf hoffen, doch noch evakuiert zu werden.
Der 30. August 2021 ist ein trauriger Tag für die internationale Gemeinschaft.