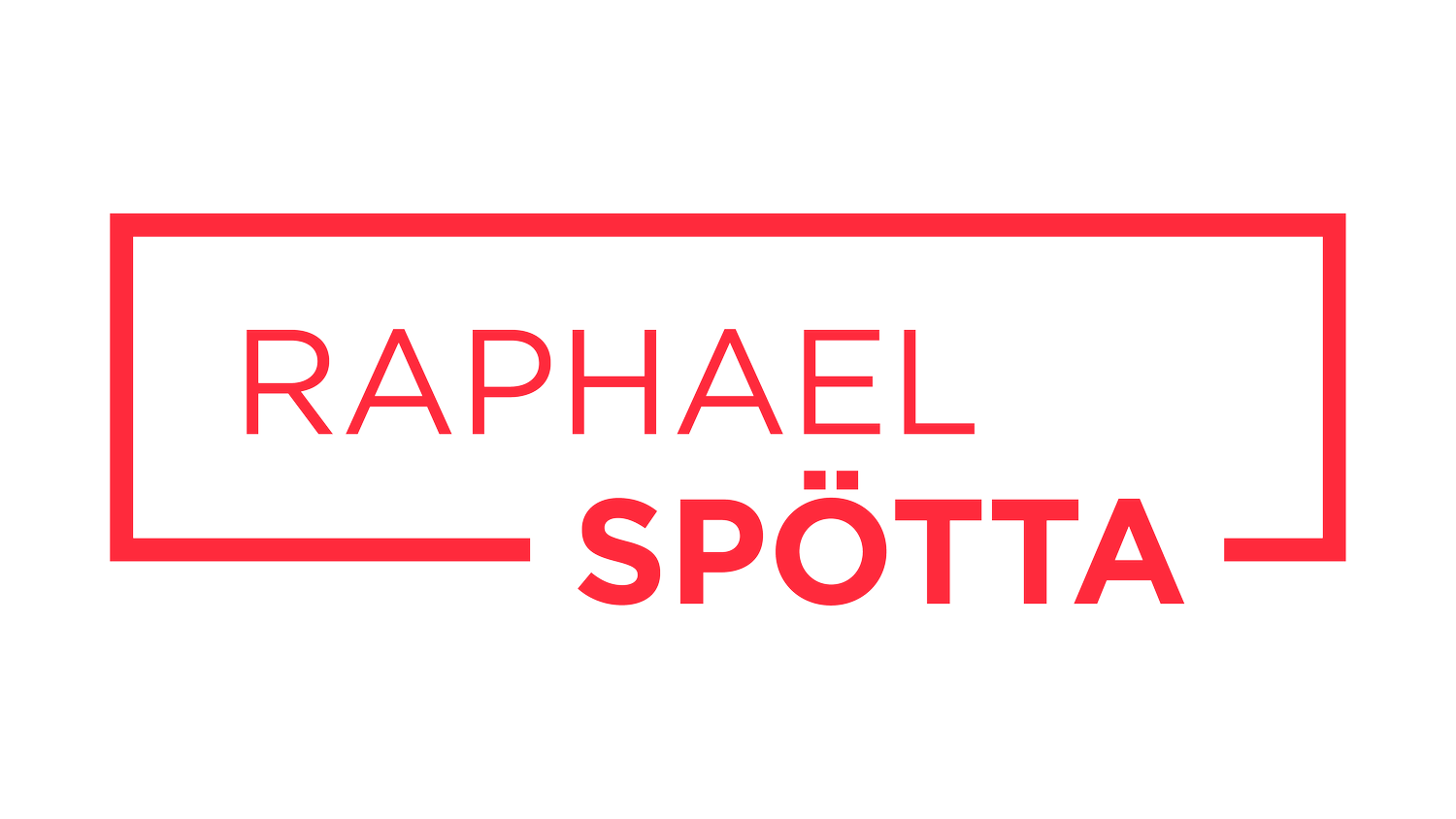Der Wendepunkt
Am 24. Februar 2022, gegen 6.00 Uhr morgens, begann der Angriff Russlands auf die Ukraine. In den frühen Morgenstunden dieses 24. Februars hatte der russische Präsident Vladimir Putin im Zuge einer Fernsehansprache den Beginn einer „Spezialoperation“ der russischen Streitkräfte in der Ukraine angekündigt. In der Realität handelte es sich um eine Großoffensive Russlands gegen die Ukraine.
Dem waren Monate der Spekulation und intensiver Verhandlungen vorausgegangen. Russland hatte im November 2021 damit begonnen, Truppen an der Ostgrenze der Ukraine zusammenzuziehen. Mitunter war von bis zu 175.000 Soldat:innen die Rede. Der Zweck dieses Truppenaufmarsches blieb zunächst allerdings unklar. Handelte es sich bloß um eine Drohkulisse oder erwog Russland tatsächlich eine Invasion der Ukraine?
Diplomatischer Marathon
Es folgten zahlreiche diplomatische Besuche. Russland hatte Forderungen nach "Sicherheitsgarantien" erhoben, die de facto das Ende der NATO bedeutet hätten – dies wurde aber vor allem als russische Maximalforderung verstanden. Also folgten Verhandlungen: Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron besuchte Russlands Präsidenten Putin und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz absolvierte einen Besuch bei US-Präsident Joe Biden. Auch die Außenministerin der „Ampelkoalition“ Annalena Baerbock sprach mit ihrem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov und fasste die diplomatische Stimmung konzise zusammen: es sei schwer, den massiven russischen Truppenaufmarsch nicht als Drohung zu verstehen. Immerhin schätzten selbst ukrainische Generale, dass Russland die Ukraine ohne westliche Hilfe binnen weniger Tage überwältigen würde.
Für kurze Zeit schien die Diplomatie tatsächlich Erfolg zu versprechen. Niemand wolle Krieg, ganz besonders Russland nicht, versicherte etwa Lavrov. Der ukrainische Präsident Volodimir Selenskyi warnte vor Alarmismus, das Gerede vom Krieg sei lediglich Panikmache. Macron wiederum meinte, eine Einigung sei in unmittelbarer Reichweite.
‚Momentan greifen sie nicht unsere Erde an, sondern unsere Nerven. Wir sollen in ständiger Angst leben‘, sagt Wolodimir Selenski mit düsterer Miene an sein Volk gerichtet über Russland und einen möglichen Krieg. ‚Keine Panik‘, ruft der ukrainische Präsident in die Kamera […]. Jeden Tag darüber zu reden oder zu berichten, ‚dass der Krieg kommt, wird ihn sicher nicht aufhalten‘[…].
Mathias Brüggmann, Handelsblatt, 30. Jänner 2022
Dann kam der Paukenschlag: in einer Fernsehansprache kündigte Putin an, dass Russland die separatistischen Gebiete Donezk und Luhansk als unabhängige „Volksrepubliken“ anerkennen werde. Deren Bitten um Unterstützung beantwortete der Kreml mit der Entsendung russischer Truppen in die Ostukraine. Viele Beobachter:innen fassten dieses Vorgehen als Kriegserklärung Russlands an die Ukraine auf. Wie sich herausstellte, lagen sie damit vielleicht nicht rechtlich, wohl aber politisch richtig. Die Anerkennung der „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk als eigenständige Staaten diente offensichtlich als Vorwand und Legitimationsgrundlage für die Entsendung russischer Truppen in die Ostukraine – und auch über die ehemalige Kontaktlinie im Donbas hinaus.
Mit einem tatsächlichen russischen Großangriff auf die Ukraine hätten nur die wenigsten gerechnet. Viele glaubten an einen Bluff Russlands, der den „Westen“ zu Verhandlungen zwingen sollte. Die Drohkulisse an der ukrainischen Ostgrenze war allerdings derart umfassend, dass Zweifel an einem bloßen Bluff angebracht waren. Eher plausibel erschien einigen die Variante, dass sich Russland noch nicht endgültig entschieden hatte, ob es die Ukraine angreifen sollte. Dass Putin tatsächlich den Angriff befehlen würde, dass in Europa tatsächlich ein Krieg beginnen würde, schien den meisten abwegig bzw. unvorstellbar. Auch war unklar, welche Ziele Russland tatsächlich verfolgte. Auch die Sicherheitsgarantien, die Russland von den USA und der NATO verlangte, ließen es unwahrscheinlich erscheinen, dass sich Moskau tatsächlich für einen Großangriff entscheiden würde – es schien eher, als würde der Kreml die Ukraine und damit den Westen unter Druck setzen wollen, um eine Form der Sicherheitsgarantien zu erhalten.
Der Wendepunkt
Der 24. Februar 2022 war ein Wendepunkt und eine Zäsur in der europäischen Geschichte. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz nannte diesen Tag in seiner Regierungserklärung vom 27. Februar vor dem deutschen Bundestag eine „Zeitenwende“.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts, oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.
Olaf Scholz, 27. Februar 2022
In derselben Rede kündigte Scholz ein immenses Investitionspaket für die Bundeswehr an. Dieses umfasst nicht nur ein Sonderinvestitionspaket im Umfang von 100 Milliarden Euro, sondern auch eine Steigerung des Verteidigungsbudgets auf über zwei Prozent des deutschen BIP (von 46,9 Milliarden auf voraussichtlich etwa 71 Milliarden Euro). Darüber hinaus sollen nicht nur bewaffnete Drohnen beschafft, sondern auch eine rasche Entscheidung für die Nachfolge des bisherigen Kampfjets "Tornado" getroffen werden. Am 14. März gab die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht die Entscheidung für die Type F-35 bekannt. Bisher erschien eine derartige Investition in die Bundeswehr unvorstellbar, war Deutschland doch in Hinblick auf verteidigungspolitische Fragen eher zurückhaltend.
Es ist ein Wendepunkt in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch, dass sich die europäischen Staats- und Regierungschefs bei einem informellen Gipfel am 11. März 2022 in Versailles darauf einigten, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, damit die EU handlungsfähiger wird. Wie weit diese Willensbekundung – solche hat es in der Vergangenheit viele gegeben – tatsächlich in einer echten, gemeinsamen Verteidigungspolitik Europas münden wird, muss aktuell offen bleiben. Ist Europa tatsächlich dazu bereit, Verantwortung für seine eigene Sicherheit zu übernehmen? Für die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten ist die NATO-Mitgliedschaft vermutlich mindestens ebenso wichtig für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Eine Reform hin zu echter Einsatzbereitschaft der EU ist ohne substanzielle Reformschritte kurz- bis mittelfristig unwahrscheinlich. Das erfordert politischen Willen aller Mitgliedsstaaten, ansonsten wird von dieser Wende in der Sicherheitspolitik der Union nicht viel übrigbleiben.
Dem kann mit einigem Recht der Beschluss des Strategischen Kompasses der Europäischen Union am 21. März 2022 entgegengehalten werden. Dieser sieht Reformen in verschiedenen Bereichen vor – Krisenmanagement, Resilienz, Fähigkeiten und Partnerschaften. Vor allem aber wurde der raschen Eingreiftruppe mediale Aufmerksamkeit zuteil. Diese soll die noch nie eingesetzten EU-Battlegroups ersetzen und bis zum Jahr 2025 die Union dazu befähigen, bis zu 5.000 Soldat:innen in ein unkooperatives (also feindliches) Umfeld zu entsenden. Auch Österreich wird sich hieran beteiligen; mit welchen konkreten Fähigkeiten ist derzeit noch nicht festgelegt. Ob diese Rapid Deployment Capability tatsächlich eingesetzt werden wird, wird sich erst noch weisen.
Die Zäsur
Bereits seit Längerem wird über die strategische Autonomie der EU, über die Handlungsfähigkeit der Union im Sicherheits- und Verteidigungsbereich diskutiert. Auch der Strategische Kompass ist im Lichte dieser Diskussion zu sehen. Während der Präsidentschaft Donald Trumps war die strategische Autonomie Europas verstärkt Diskussionsgegenstand. Zu nennen ist hier vor allem ein bemerkenswertes Interview des Nachrichtenmagazins „Economist“ mit dem französischen Staatspräsidenten Macron aus dem Jahr 2019. Hierin warnte Macron davor, dass die NATO „hirntot“ zu werden drohte.
Hintergrund dieser Diskussion war stets eine sich zusehends verschlechternde Sicherheitslage in der europäischen Nachbarschaft. Beispielhaft zu nennen wären hier unter anderem Mali, Syrien, Afghanistan oder auch die Ukraine selbst. Hinzu kommt eine Zunahme an hybriden Aktivitäten innerhalb Europas sowie Cyberangriffe. Europas Sicherheit muss auch durch Europa verantwortet werden. Ein derart aggressives, militärisches Vorgehen wie von Russland gegen die Ukraine hat es in Europa jedoch seit Langem nicht gegeben. Der offensichtliche Charakter des Angriffskriegs in einer derartigen Dimension ist also eine Zäsur.
Blickt man über Europa hinaus, zeigt sich allerdings, dass militärische Konflikte alles andere als selten sind. Beispiele hierfür finden sich zuhauf: der Konflikt in Afghanistan, der Bürgerkrieg in Syrien, die militärischen Konflikte in Libyen und in Mali oder auch der Krieg zwischen Azerbaijan und Armenien. Die geostrategische Lage in Europa hat sich seit Jahren verschlechtert und militärische Konflikte sind nicht mehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich und ungeheuerlich ist allerdings die Tatsache, dass ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats einen derart eklatanten Verstoß gegen Artikel 2(4) der Charta der Vereinten Nationen, das allgemeine Gewaltverbot, und darüber hinaus mutmaßliche Kriegsverbrechen begeht. Das betrifft vor allem das Bombardement eindeutig ziviler Ziele wie etwa in der Stadt Mariupol, aber auch den Einsatz von thermobarischen Waffen wie der TOS-1A.
Zeitenwende?
Der vielleicht größte Umbruch ist, dass Europa erkannt hat, dass es bereits seit Längerem zu einer schleichenden Zeitenwende kommt, und man sich wachsenden Problemen und Unsicherheiten stellen muss. Diese zeichnen sich bereits seit Jahren ab. Offenbar hat erst der Angriff Russlands auf die Ukraine gezeigt, dass Europa seine Sicherheits- und Verteidigungspolitik überdenken sollte. In Deutschland geschieht dies mit massiven Investitionen in die Bundeswehr und mit einer Budgetsteigerung auf über zwei Prozent des BIP. Damit wird noch nicht aufgerüstet, sondern erst der Investitionsstau behoben werden. Alleine für die Nachbeschaffung von Munition scheint ein „zweistelliger Milliardenbetrag“ zu fehlen. Auch in Österreich wird seither eine mögliche Budgetsteigerung (mehr oder minder) diskutiert.
Alleine das wird jedoch nicht reichen. Russland hat bereits gezeigt, dass es wieder zu einer Logik des Kalten Kriegs zurückgekehrt ist. Die Kooperation mit Europa liegt in verschiedensten Bereichen (verständlicherweise) auf Eis. Es ist nicht undenkbar, dass Russland etwa die Mandatsverlängerung von UNIFIL mit einem Veto blockiert. Das betrifft nicht nur den Nahen Osten, sondern alle geografischen Räume, in denen Österreich seine Schwerpunkte gesetzt hat: Südosteuropa, den Nahen Osten, Afrika und natürlich Osteuropa. Wie sich die Sicherheitslage in diesen Räumen entwickeln wird, ist derzeit noch unklar, mit einer Verschlechterung ist hingegen jedenfalls zu rechnen.
Ausblick
Aktuell sind Sanktionen und Waffenlieferungen die einzig gangbaren Möglichkeiten für die USA und Europa, die Ukraine zu unterstützen. Ein militärisches Eingreifen gegen Russland darf hingegen nicht ernsthaft erwogen werden. Ein Konflikt zwischen der NATO, die als einzige Organisation nennenswerte militärische Operationen in der Ukraine durchführen könnte, und Russland wäre der Auftakt zu einem potenziell verheerenden Krieg in Europa, möglicherweise sogar eines Weltkriegs.
„Die NATO-Verantwortlichen haben klar erklärt, dass eine Involvierung von NATO-Streitkräften in der Ukraine nicht beabsichtigt ist. Wenn russische Übergriffe auf NATO-Territorium stattfänden, wäre das allerdings ein Fall für den Artikel 5 [des Nordatlantikvertrags], das heißt den Verteidigungsfall für das atlantische Bündnis, wo der Angriff auf einen Mitgliedsstaat als Angriff auf alle gewertet wird, einschließlich der Vereinigten Staaten.“
General Brieger in der Zeit im Bild 2 vom 24. Februar 2022
Auch eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union ist realistischerweise undenkbar. Ein „Schnellverfahren“ für den Beitritt gibt es nicht. Erst nach einem langen und komplexen Verfahren kann überhaupt erst der Status als Beitrittskandidat verliehen werden. Dann erst beginnen die Verhandlungen. Im Wesentlichen muss ein Land dabei die Konvergenzkriterien (Maastricht-Kriterien) erfüllen und das gesamte EU-Recht (acquis communautaire) in seine Rechtsordnung integrieren. Das ist kein einfacher Vorgang, den man signifikant beschleunigen könnte.
Viele weitere Entwicklungen hängen vom Verlauf des Krieges in der Ukraine ab. Auch, wenn sich die ukrainischen Streitkräfte mehr als hervorragend schlagen und Russland empfindliche Verluste zugefügt haben – es wäre ein Fehler, Russland nun militärisch zu unterschätzen. Zudem besteht immer noch die (unwahrscheinliche) Möglichkeit, dass Russland den Konflikt nuklear eskaliert, also eine kleinere, taktische Atomwaffe gegen die Ukraine einsetzt. Unwahrscheinlich ist dieses Szenario deshalb, da Russland mit noch weiteren, schmerzhaften Sanktionen rechnen muss und sich noch weiter international isolieren würde. Ein derartiges Vorgehen mag jedoch wahrscheinlicher werden, je länger der Konflikt andauert.
Eine Tatsache bleibt jedoch bestehen und kann nicht wegdiskutiert werden: Europa wird mit Russland ein Auskommen finden müssen. Das wird zwar durch das russische Vorgehen in der Ukraine erschwert und würde durch den Einsatz von Nuklearwaffen fast verunmöglicht. Es bleibt jedoch eine politische Realität: Russland ist und bleibt der Nachbar Europas. Wir müssen Moskau mittel- bis langfristig zu einem Akteur machen, der die Sicherheitsarchitektur Europas mitträgt, anstatt sie zu untergraben.