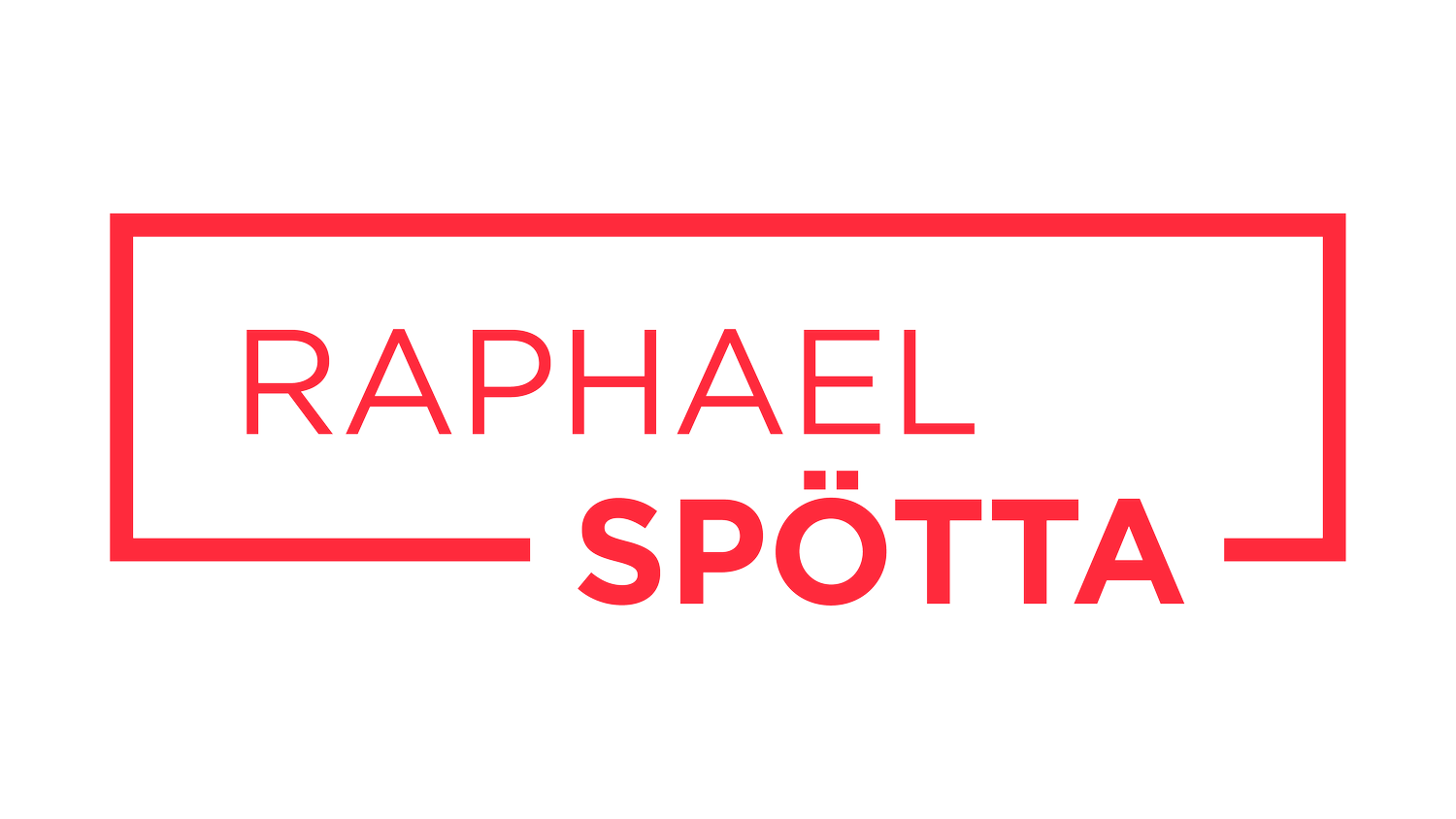Nordmazedoniens europäischer Weg
Der große Prespa-See ist ein unberührtes Naturjuwel. Ungefähr drei Stunden von Skopje entfernt, liegt der See im Dreiländereck zwischen Albanien, Griechenland und Nordmazedonien. Fernab von der Hektik des Alltags findet man eine unberührte Seenlandschaft mit kristallklarem Wasser, eine große Artenvielfalt und auf der im Zentrum des Sees gelegenen Insel sogar römische Ruinen.
Doch in gewisser Weise symbolisiert der See weit mehr als ein traumhaftes Urlaubsziel: Er steht sinnbildlich für die europäische Einigung. Nicht nur, dass er auf dem Gebiet von drei europäischen Staaten liegt. Dort wurde auch das historische Prespa-Abkommen zwischen Mazedonien und Griechenland geschlossen, welches den Namensstreit beilegen sollte. Dieses sieht vor, dass Mazedonien seinen Namen in "Republik Nordmazedonien" ändert. Im Gegenzug verpflichtete sich Griechenland, seinen Widerstand gegen die Aufnahme Nordmazedoniens in EU und NATO aufzugeben. Nach einer Zitterpartie sowohl im griechischen als auch im nordmazedonischen Parlament wurde das Prespa-Abkommen schließlich angenommen. Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien änderte offiziell ihren Namen in Republik Nordmazedonien.
Der Weg nach Europa war aber noch nicht frei, denn 2019 stimmte Frankreichs Präsident Macron gegen die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien. Es brauche, bevor die Gespräche beginnen könnten, erst substanzielle Reformen des EU-Erweiterungsmechanismus, so der französische Präsident. Die meisten Beobachter jedoch hielten das für einen schweren Fehler – inklusive des ehemaligen Kommissionspräsidenten Juncker. Dieser bezeichnete das französische Veto als „historischen Fehler“. Denn es ist in erster Linie die Glaubwürdigkeit Europas, die auf dem Spiel steht.
If the EU is to be respected in the world, it has to stick to its promises.
Von Ohrid nach Prespa
Für Nordmazedonien war diese Entscheidung doppelt hart, denn Skopje hat bereits einen weiten Weg in Richtung Europa zurückgelegt. Nach dem Zerfall Jugoslawiens 1991 und der Aufnahme einer Vielzahl von Flüchtlingen aus dem Kosovo 1999 kam es in Mazedonien selbst zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Erst mit dem Rahmenabkommen von Ohrid wurde ein Waffenstillstand zwischen der albanischen UÇK und der mazedonischen Regierung geschlossen. Nachdem dem Land 2005 der Status eines Beitrittskandidaten verliehen wurde, stockte Mazedoniens Entwicklung. Der konservative Premierminister Nikola Gruevski schaffte es nicht, wichtige politische Initiativen zu setzen, im Gegenteil.
Die Flüchtlingskrise 2015 setzte Skopje noch mehr unter Druck. Weder war das Land selbst dazu imstande, den Durchzug von tausenden Flüchtlingen zu administrieren, noch erhielt man Hilfe von der EU. Doch Gruevski geriet erst dann unter Zugzwang, als ein massiver Korruptionsskandal aufgedeckt wurde. Der damalige Oppositionsführer Zoran Zaev warf dem Premierminister vor, mindestens 20.000 Personen des öffentlichen Lebens abzuhören und Staatsgelder zu veruntreuen. Nachdem er zurückgetreten war, erhielt Gruevski politisches Asyl in Ungarn. Dies jedoch erst, nachdem man ihn in ungarischen Diplomatenfahrzeugen und mit gefälschtem bulgarischem Pass quer durch Albanien, Montenegro und Serbien nach Ungarn geschmuggelt hatte. Budapest verweigert seither Gruevskis Auslieferung an Nordmazedonien.
Als neuer Premierminister hat Zoran Zaev einige wichtige Reformschritte gesetzt, allen voran in den Bereichen der Justiz und der Korruptionsbekämpfung. Es ist vor allem der Reformwille der derzeitigen regierenden Partei SDSM, die den Ausschlag für wichtige Reformbestrebungen gegeben hat. Allen voran sind es natürlich Zaev, aber auch die Verteidigungsministerin Radmila Šekerinska, die eine europäische Perspektive Nordmazedoniens für zentral halten und daher verstärkt den internationalen Dialog suchen. Ohne deren Initiative hätte es wahrscheinlich im Namensstreit keinen Kompromiss gegeben.
Der weite Weg
Die Reformbestrebungen haben sich letztlich doch gelohnt. Vergangene Woche haben die 27 EU-Mitgliedsstaaten den Beginn von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien im Rat beschlossen. Auch, wenn eine Bestätigung der Staats- und Regierungschefs noch aussteht, ist das ein wichtiges Zeichen dafür, dass es Europa doch ernst nehmen könnte mit der Aufnahme der Westbalkan-Staaten. Das wiederum zeigt, dass man sich von der wichtigen Rolle als internationaler Stabilitätsfaktor noch nicht verabschiedet hat.
Mit der heutigen politischen Einigung über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und der Republik Nordmazedonien werden die intensiven Reformbemühungen dieser beiden Länder anerkannt. Beide haben die klare politische Entschlossenheit gezeigt, auf ihrem Weg in die Europäische Union voranzukommen. Der Weg zum Beitritt ist lang. Wenn jedoch echte und nachhaltige Fortschritte bei der Erfüllung der Beitrittskriterien erzielt werden, bringt das die Partner im westlichen Balkan näher an die EU heran.
Andreja Metelko-Zgombic, kroatische Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten
Die meisten Westbalkan-Staaten haben berechtigtes Interesse an einem EU-Beitritt. Wirtschaftliche Gründe spielen ebenso eine wichtige Rolle wie das Mitspracherecht bei der Entscheidungsfindung und die erwartete politische Stabilität. Im Gegenzug müssen diese Staaten jedoch weitreichende Reformen durchführen – beispielsweise Reformen im Bereich des Sicherheitssektors oder der Rechtsstaatlichkeit. Haben sie jedoch keine Aussicht, tatsächlich in die EU aufgenommen zu werden, schwindet auch das Interesse an langwierigen, schwierigen und aufwändigen Reformen.
Dieser Reformwille wird allerdings noch weiteren, gewichtigen Tests unterzogen werden. Viel Geduld ist erforderlich, um die Beitrittsgespräche erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Das zeigt beispielsweise ein Blick auf die Beitrittsgespräche mit dem Beitrittskandidaten, dessen Aussichten, bald beizutreten am besten bewertet werden: Serbien. In den Verhandlungen mit Serbien, die 2009 begonnen haben, wurden gerade einmal zwei von 35 Kapiteln geschlossen.
Eine Frage europäischer Glaubwürdigkeit
Der Beschluss, nun Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien zu eröffnen, ist überfällig. Doch die europäische Glaubwürdigkeit auf dem Balkan ist damit noch nicht wiederhergestellt. Die meisten Menschen vor Ort haben wohl die Hoffnung aufgegeben, den EU-Beitritt ihrer jeweiligen Staaten noch zu erleben. Zu lange hat man die Westbalkan-Staaten auf die lange Bank geschoben. Zu lange hat man sie vertröstet und Anforderungen an sie gestellt, die sie bei Erfüllung doch nicht dazu berechtigen, Beitrittsverhandlungen zu beginnen. So gesehen ist der Beschluss des Rats ein Trostpflaster. Es ist eine reale Möglichkeit, dass die Verhandlungen sich noch sehr lange hinziehen und nach deren Abschluss gibt es keine Garantie, keinen Automatismus dafür, dass ein EU-Beitritt möglich ist.
Für die Glaubwürdigkeit Europas wäre das ein Armutszeugnis sondergleichen und gewissermaßen eine Einladung dazu, sich anderweitig zu orientieren – Russland, China, die Türkei. Eine europäische Perspektive der Westbalkan-Staaten aufrecht zu erhalten, wäre aber für die Stabilität und die Sicherheit der Region unerlässlich. Die Aussicht, Konflikte mit friedlichen Mitteln beizulegen, um die Mitgliedschaft in der EU nicht zu gefährden, ist ein wesentlicher Anreiz. Glaubwürdigkeit in diesem Zusammenhang heißt auch, dass dem grünen Licht für Verhandlungen letztlich auch ein Beitritt folgen muss. Die Alternative wäre, uns von der geopolitischen Verantwortung Europas zu verabschieden.
Beitragsbild: Alexandros Michailidis/Shutterstock