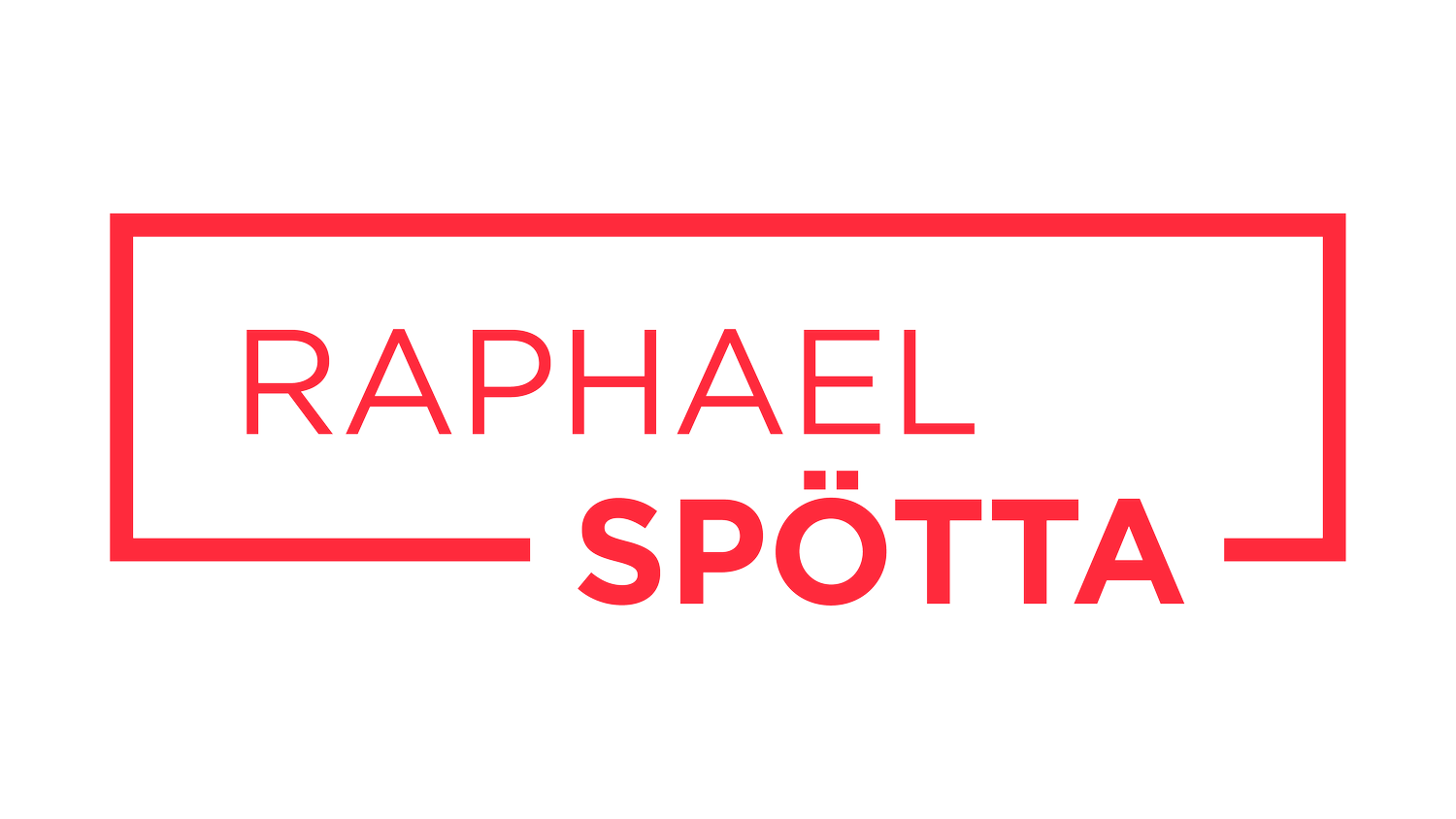Enttäuschte Hoffnungen
Dienstag, der 12. Mai 2020. Eine Gruppe bewaffneter Männer dringt in ein Krankenhaus der Médecins Sans Frontières in Dasht-e Barchi, der am dichtesten besiedelte Bezirk der afghanischen Hauptstadt Kabul, ein. Ihr Ziel: die Entbindungsstation. An diesem Dienstag waren 26 Betten belegt. Die Bewaffneten dringen in die Station ein und durchkämmen die Räume systematisch. Jede Person, die sie finden, erschießen sie – vor allem und insbesondere die Mütter und ihre ungeborenen Kinder. Auch vor dem Kreißsaal machen sie nicht halt. Nach vier Stunden ist der Mordanschlag vorbei, 24 Menschen sind tot, davon sind 16 Patientinnen.
„Die Angreifer sind durch die Räume gegangen und haben Mütter in ihren Betten erschossen. Systematisch. Was ich vorfand, waren Einschusslöcher in den Wänden, blutverschmierte Böden, ausgebrannte Fahrzeuge und zersplitterte Fenster, durch die hindurch geschossen wurde.“
Frederic Bonnot, Landeskoordinator Afghanistan, MSF
An jenem Tag in Kabul wurde ein gezielter Anschlag auf die Menschlichkeit verübt. Noch am selben Tag kündigte Präsident Ashraf Ghani an, die Offensive gegen die Taliban wieder aufnehmen zu wollen. Bisher hatten die afghanischen Sicherheitskräfte lediglich verteidigende Stellungen eingenommen. Der Hintergrund: die Friedensgespräche zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban. Um den Friedensprozess nicht zu gefährden, hatten sich die USA und die Taliban in ihrem Abkommen vom 29. Februar auf einen Waffenstillstand geeinigt. Diese Übereinkunft hatte außerdem Verhandlungen mit der afghanischen Regierung vorgesehen, die aber an der Aushandlung des Taliban-Deals nicht beteiligt gewesen war. Schon damals hatten Analysten gewarnt, dass das Abkommen zu ambitioniert und dessen Umsetzung alles andere als sicher sei, doch US-Präsident Trump hielt nichtsdestotrotz daran fest.
Verhandlungen finden jähes Ende
Am Ende waren die Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung in Kabul und den Taliban vorbei, noch bevor sie richtig begonnen hatten. Der Grund dafür waren Uneinigkeiten über einen möglichen Gefangenenaustausch. Die Forderung der Taliban, dass 15 ihrer hochrangigen Kommandanten freigelassen werden sollten, konnte Kabul nicht erfüllen. Stattdessen hatte man vorgeschlagen, 400 weniger gefährliche Gefangene freizulassen, wenn die Taliban zusichern würden, dass sie die Gewalt deutlich reduzieren. Ein Vorschlag, den die Islamisten zurückwiesen. Anfang April folgte der offizielle Abbruch der Gespräche – bis Kabul einen Tag später hunderte Taliban freiließ. Ein unilaterales Zeichen des guten Willens seitens der Regierung. Wenige Tage später kündigten die Taliban die Freilassung von 20 Gefangenen an. Nichtsdestotrotz wurden die Gespräche nicht fortgesetzt.
Stattdessen uferte die Gewalt aus. Die Taliban verübten immer mehr Anschläge, die immer mehr Todesopfer forderten. Am 08. Mai wurde der Polizeichef der östlichen Provinz Khost durch eine Autobombe getötet. Vier Tage später fand ein Selbstmordanschlag auf eine Trauerfeier in der Provinz Nangarhar statt – und der Angriff auf die Geburtenstation in Dasht-e Barchi. Die Taliban waren offensichtlich wieder in der Offensive – und das trotz des Abkommens mit den Vereinigten Staaten. Oder findet diese Offensive vielleicht gerade aufgrund des Abkommens, aufgrund der deklarierten Absicht der Trump-Administration, sich aus Afghanistan zurückziehen zu wollen und des bereits erfolgten Rückzugs von Teilen der US-Streitkräfte statt?
Der Mann, der auszog, Afghanistan zu retten
Seit Jahren schon sind in Afghanistan keine Erfolge der internationalen Koalition zu verzeichnen. Der letzte wirklich große Erfolg der USA fand nach der Invasion im Jahr 2001 statt, als die Taliban-geführte Regierung zusammenbrach. Seither befindet sich Afghanistan in einem Dauerkonflikt, in dem keine Seite die Oberhand gewinnen konnte. Der afghanischen Regierung, unterstützt durch die internationale Koalition, gelang es nicht, die Taliban nachhaltig zu besiegen. Ganz im Gegenteil – trotz immer stärkeren Engagements verbesserte sich die Lage nicht. Am ehesten hätte man die Situation als erodierenden Frieden bezeichnen können. Bis zur Präsidentschaft von Barack Obama hatten die USA kein klares Ziel, keine klare Strategie und keine klare Vorstellung davon, was sie in Afghanistan erreichen wollten. Während Obamas acht Jahren im Weißen Haus wurde das Für und Wider des Kriegs wiederholt diskutiert, die Debatte drehte sich vor allem um die Truppenstärke der USA.
Donald Trumps politische Ziele sind anders gelagert. Sein Ziel ist ein Abzug der US-Truppen, koste es, was es wolle. Dabei ignoriert Trump ein seit 2001 bestehendes vitales Interesse der USA: in Afghanistan dürfe kein Safe Haven für Terroristen entstehen. Wie dieses Ziel erreicht werden sollte, war zwar unklar, doch eine Truppenpräsenz der USA schien unabdingbar. Wollte man die Truppen abziehen, müsste man eine Verhandlungslösung mit den islamistischen Taliban erzielen, das war von Anfang an klar. Dafür war ein Höchstmaß an Kompromissbereitschaft erforderlich und Verhandlungen mit den Taliban auf höchster Ebene.
Das war der Hintergrund der Gespräche in Qatar. Vergangenes Jahr hatte Zalmay Khalilzad, der Sondergesandte des US-Außenministeriums für Afghanistan und selbst gebürtiger Afghane, geheime Verhandlungen mit den Taliban in Doha begonnen. Das Ziel war klar: Der längste Krieg der USA sollte beendet und die Truppen in die Heimat zurückgeholt werden. Getrieben vom Wunsch, das zu erreichen, was weder Präsident Bush noch Präsident Obama erreicht hatten und von diesem Erfolg bei den Präsidentschaftswahlen 2020 zu profitieren, setzte Trump ein ambitioniertes Zeitfenster. Und tatsächlich gelang – nach einigem Hin und Her sowie einem zwischenzeitlichen Abbruch der Gespräche – das Unwahrscheinliche. Khalilzad erreichte eine Übereinkunft mit den Taliban.
Gespräche entgegen aller Wahrscheinlichkeit
Es gab nur einen Nachteil, dieser war dafür umso entscheidender. Teile der Verhandlungsmaterie betrafen Souveränitätsrechte der afghanischen Regierung unter Präsident Ashraf Ghani; so waren in dem Abkommen zwischen USA und Taliban Friedensgespräche zwischen Kabul und den Islamisten vorgesehen. Weder Ghani noch sonst jemand aus seiner Regierung waren allerdings in die Verhandlungen eingebunden. Das mag zu ihrem vergleichsweise raschem Abschluss beigetragen haben, sorgte in Kabul allerdings für Unverständnis und auch Skepsis. Wie es zu erwarten war, stockten diese Verhandlungen dann schon kurz nach ihrem Beginn – offensichtlich war man zu optimistisch, was ihren Erfolg betrifft. Trump, wohl in der Überzeugung, dass die Verhandlungen schon in irgendeiner Form gelingen würden, hatte keine Rücksicht auf die Lage vor Ort genommen. Mit dem dringenden Wunsch, sich aus Afghanistan zurückzuziehen, hat er den gesamten Friedensprozess aufs Spiel gesetzt. Damit wissen die Taliban, dass das US-Engagement ein Ablaufdatum hat und sie auf Zeit spielen können.
War ein Friedensabkommen zwischen afghanischer Regierung und Taliban von Anfang an unwahrscheinlich, ist es jetzt, mit den Gewaltaktionen der Islamisten in weite Ferne gerückt. Kabul muss reagieren und kann nicht ohne Weiteres mit den Taliban weiterverhandeln. So hat Ashraf Ghani bereits angekündigt, die Offensive gegen die Taliban wieder aufzunehmen. Klar ist jedoch eines: eine neue Offensive wird den Konflikt mit den Taliban nicht lösen, im Gegenteil. Nur dann, wenn eine grundsätzliche Einigung erzielt wird, kann man derartig abscheuliche Verbrechen wie in der Entbindungsstation in Dasht-e Barchi vielleicht von vornherein verhindern. Das wissen auch alle Beteiligten, insbesondere Ashraf Ghani.
Kabul ist gespalten
Dass trotz allem immer noch grundsätzliche Gesprächsbereitschaft besteht, zeigt die Übereinkunft zwischen Ghani und seinem politischen Rivalen Abdullah Abdullah, der als Vorsitzender des Nationalen Aussöhnungsrats de facto für die Leitung der Gespräche mit den Taliban verantwortlich zeichnen wird. Das war Teil einer politischen Absprache, die den Konflikt zwischen den beiden Rivalen beilegen sollte. Zuvor hatte Abdullah nach den letzten Präsidentschaftswahlen Ghani Wahlbetrug vorgeworfen, das amtliche Endergebnis nicht anerkannt und sich als „Gegenpräsident“ vereidigen lassen.
Mit dem politischen Kompromiss zwischen Ghani und Abdullah ist die afghanische Regierung erstmals seit den Präsidentschaftswahlen 2019 geeint. Das ist bereits ein Erfolg, egal, ob sie ihre militärische Offensive gegen die Taliban oder aber die Friedensverhandlungen weiterführen will. Letzteres ist in nächster Zeit kaum vorstellbar. Im Augenblick werden beide Seiten versuchen, durch militärische Aktionen oder Anschläge die jeweils andere Seite unter Druck zu setzen.
Der unausweichliche Konflikt
Selbst wenn jedoch das Unwahrscheinliche geschieht und die beiden Parteien doch an den Verhandlungstisch zurückkehren sollten, ist ein Erfolg keineswegs sicher, ganz abgesehen davon, dass der Frieden nicht alleine in den Händen der afghanischen Taliban liegt. Das liegt an der stark verwurzelten Stammesstruktur des Landes. Peter Lavoy, der Unterstaatssekretär für Sicherheitsfragen in Asien und dem Pazifik unter Präsident Obama, wies bereits vor Jahren auf genau diese Problematik hin. Selbst, wenn die Taliban aufhören würden, zu existieren, so Lavoy, gebe es Konflikte. Darüber hinaus berücksichtigten weder das Abkommen noch die innerafghanischen Gespräche die Notwendigkeit, mit Afghanistans Nachbarn Pakistan eine Verständigung zu erreichen. Der pakistanische Zweig der Taliban untersteht nicht der Autorität ihrer afghanischen Nachbarn.
Dr. Peter Lavoy, Obama’s deputy assistant secretary of defense for Asian and Pacific security affairs, later in charge of South Asia for the Obama NSC staff, was a soft-spoken authority on South Asia—Pakistan and Afghanistan. […] He believed the obsession with U.S. troop numbers had been the Achilles’ heel of the Obama administration policy in Afghanistan. “There are literally thousands of sub-tribes in Afghanistan,” Lavoy said. “Each has a grievance. If the Taliban ceased to exist you would still have an insurgency in Afghanistan.” Victory was far-fetched. Winning had not been defined.
Bob Woodward: Fear. Trump in the White House, S. 116
So oder so weist der Friedensprozess in Afghanistan mehr als nur ein paar ungeklärte Fragen auf und sorgt ebenso für Verunsicherung. Gelingt es Kabul und den Taliban doch noch, vor den US-Präsidentschaftswahlen eine Übereinkunft zu erzielen? Wird Donald Trump davon profitieren? Wird ein etwaiges Abkommen oder eine politische Übereinkunft halten und den Konflikt beilegen? Wie nachhaltig wäre eine solche Lösung? In Afghanistan geht es jetzt um Alles oder Nichts. Donald Trump wollte der Präsident sein, der die US-Truppen aus Afghanistan abziehen und die Stabilität des Landes wiederherstellen würde. Er könnte der Präsident werden, dessen Ungeduld zu einem neuerlichen Ausbruch der Gewalt führte und die Möglichkeit auf Frieden für Jahre zunichte gemacht hat.
Beitragsbild: Ryanzo W. Perez/Shutterstock