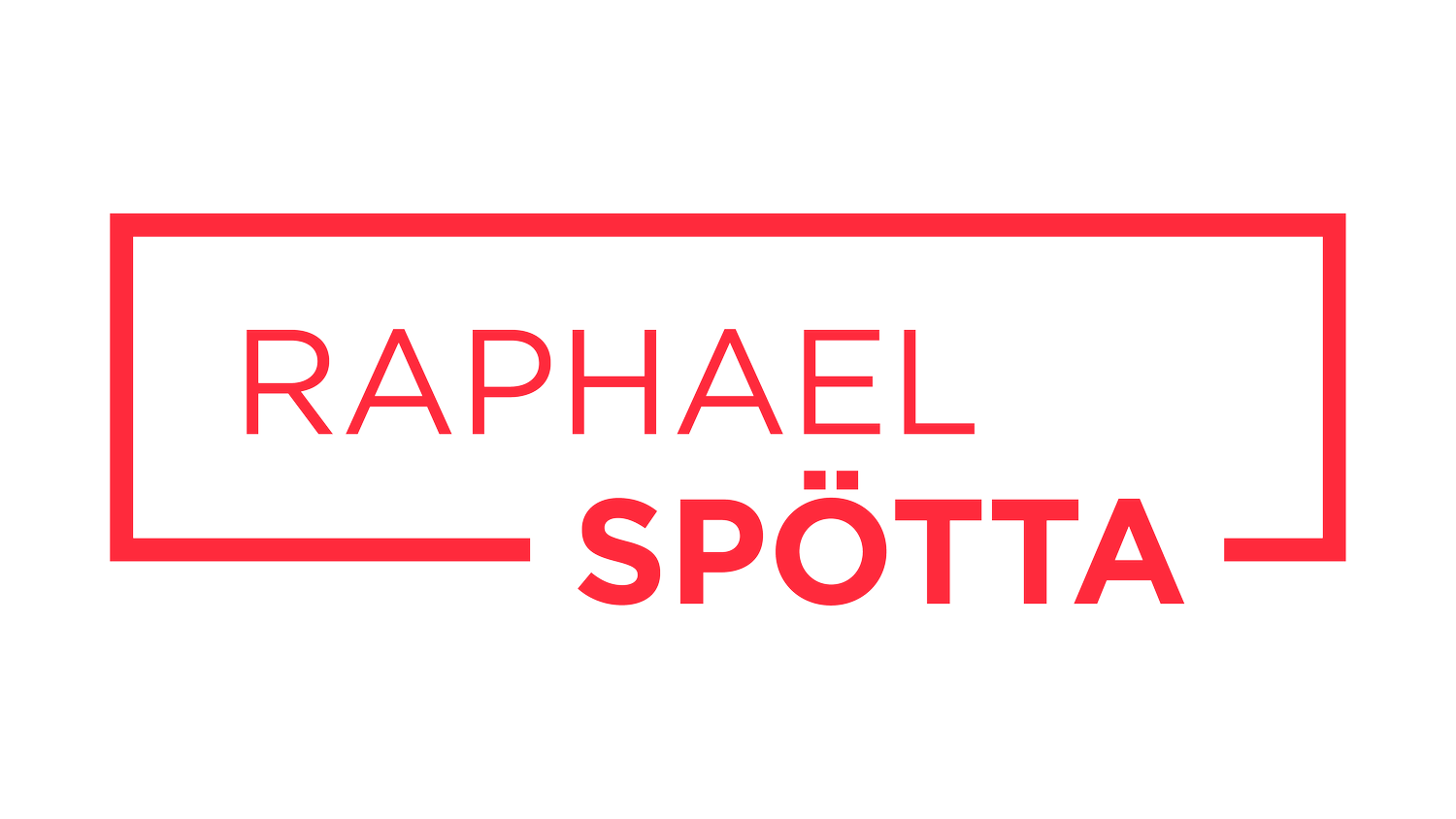Eine europäische Lösung ist erforderlich
Man könnte die Aussagen so mancher österreichischer Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker durchaus als verbale Abschottung bezeichnen. So hat beispielsweise Innenministerin Johanna Mikl-Leitner vor laufenden Kameras angekündigt, die „Festung Europa“ realisieren zu wollen und Integrationsminister Sebastian Kurz will mittels Zäunen die Grenzen schützen. Österreich ist eines der von der Flüchtlingskrise am stärksten betroffenen Länder Europas und doch scheint Wien nur zwei Lösungsansätze zu vertreten: entweder die Grenzen komplett dicht zu machen oder die Flüchtlinge nach Deutschland weiter zu winken. Doch das eigentliche Problem ist das Fehlen einer gesamteuropäischen sowie einer internationalen Lösung.
Natürlich wäre es Österreich möglich, die Grenzen komplett dicht zu machen und den Kopf in den Sand zu stecken – warum sollen sich nicht andere um die Flüchtlingsproblematik kümmern? Das würde die Probleme schlicht und ergreifend nicht lösen. Wenn es auch den einen oder anderen Kärntner Landespolitiker freuen mag, baulich Abstand zu Slowenien zu schaffen, hätte ein Grenzzaun in erster Linie abschreckende Wirkung und weniger praktischen Nutzen. Denn entweder provoziert man damit Szenen wie in Ungarn oder man verstärkt das Geschäftsmodell der Schlepper, die Menschen illegal über die Grenze bringen. Nachhaltig ist die Abschottungsoption also nicht, insbesondere angesichts der Tatsache, dass solche Zäune nichts an der Tatsache ändern, dass in Syrien ein Bürgerkrieg stattfindet. Im Gegenteil, Lösungen wie diese verlagern lediglich den Druck auf die slowenische Grenze.
Welche Handlungsoptionen bleiben Österreich und welche Handlungsoptionen bleiben Europa? Österreich als relativ kleines Binnenland in Europa kann selbst nicht allzu viel tun, außer eben seine Grenzen zu schließen. Die Logik hinter einer solchen Handlung ist klar: es geht darum, zu verhindern, dass Flüchtlinge Österreich überhaupt erst betreten können. Das häufig gebrauchte Argument, es gehe darum, Rechtssicherheit herzustellen, ist zwar scheinbar schlüssig, würde es aber vonseiten Österreichs erfordern, Flüchtlinge auch tatsächlich zu registrieren, was derzeit nicht passiert. Das ist einer der grundlegenden Fehler des derzeitigen europäischen Dublin-Asylsystems: Staaten, in denen ein Asylwerber zuerst um Asyl ansucht, sind für dessen Verfahren zuständig. Um dieses Verfahren und die damit einhergehenden Verwaltungskosten zu vermeiden, werden diese Personen gar nicht erst registriert, sondern weitergereicht – nach Österreich, Deutschland und Schweden.
Als Flüchtlinge noch nicht in nennenswerter Zahl Europa erreichten, standen Griechenland und Italien mit den Ankünften alleine da und reichten sie weiter. Doch jetzt, wo Flüchtlinge in großer Zahl Europa erreichen, stellt diese gelebte Praxis ein Problem dar. Laut Sebastian Kurz führt kein Weg daran vorbei, die Grenzen auch national zu schließen: „Ich kämpfe dafür, dass endlich Grenzsicherheit an den EU-Außengrenzen hergestellt wird. Wenn das nicht stattfindet, werden immer mehr Staaten Einzelmaßnahmen ergreifen müssen. Ich hoffe, dass wir uns das ersparen können. Wir haben nicht mehr viel Zeit.“
Die eigentliche Lösung muss allerdings europäisch sein: eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Staaten, ein solidarisch finanziertes Asylsystem sowie umfassende Integrations-, Sprach- und Deradikalisierungsprogramme sowie psychosoziale und medizinische Erstversorgung. Doch der vielleicht wichtigste Punkt ist die Beendigung der Kriege in Syrien und Afghanistan sowie die Herstellung eines stabilen Wirtschaftswachstums vor Ort. Das kann die Europäische Union alleine nicht leisten, hierfür braucht es ein Maximum an internationaler Kooperation. Da dies derzeit unwahrscheinlich ist, braucht Europa Wege, um mit dieser neuen Situation umzugehen – das kann allerdings nicht alleine Grenzschutz sein.
Beitragsbild: Orlok/Shutterstock.com