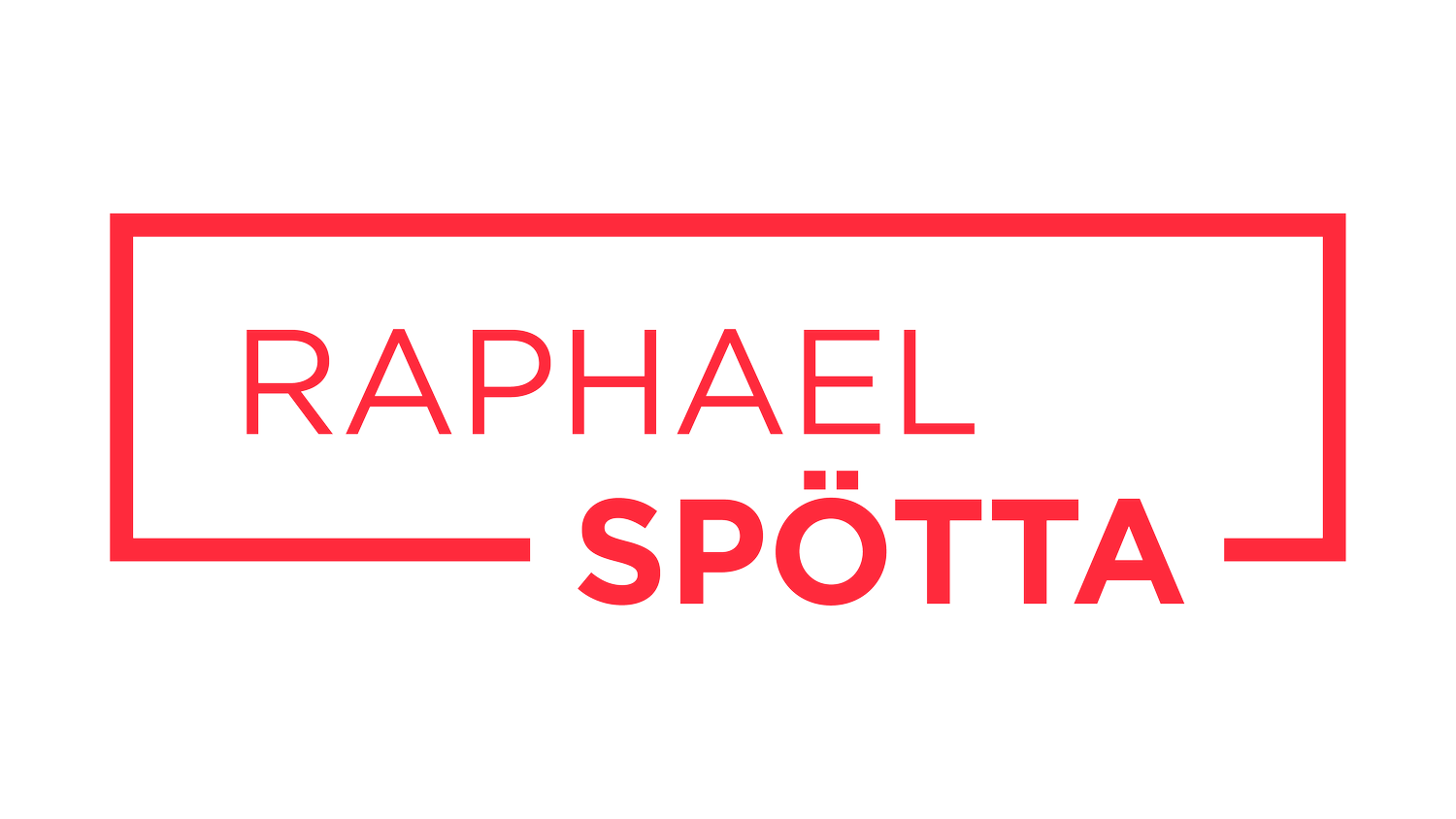Die Fehler der NATO in Libyen
Die gegenwärtigen Entwicklungen in Libyen rufen politischen, diplomatischen und journalistischen Pessimismus hervor. Das nordafrikanische Land in unmittelbarer Nähe zur Europäischen Union entwickelt sich, seit dem Beginn eines neuerlichen Bürgerkriegs letztes Jahr, scheinbar in einen Safe Haven für terroristische Aktivitäten. Manche Beobachter würden gar argumentieren, dass der Bürgerkrieg 2011, an dessen Ende der langjährige Diktator Gaddafi gestürzt worden war, 2012 und 2013 lediglich unterbrochen war. Andere sehen Libyen schlicht als gescheiterten Staat – kein unplausibles Argument angesichts der Tatsache, dass der libysche Staat einen dramatischen Mangel an Durchsetzungsfähigkeit bewiesen hat.
Wieder andere ziehen die Intervention der NATO selbst in Zweifel, wie beispielsweise Alan J. Kuperman in Foreign Affairs (März/April 2015). Es wäre besser gewesen, Gaddafi an der Macht zu belassen, so Kuperman, dies hätte eine bessere Methode bedeutet, der internationalen Schutzverantwortung (Responsibility to Protect, R2P) nachzukommen (siehe Kuperman 2015, S. 67). Eine solche Beobachtung macht allerdings etwas perplex: auf welche Weise wäre diese Alternative besser gewesen?
Bemisst man die Nachhaltigkeit des Erfolgs der NATO-Mission in Hinblick auf den Schutz von Menschenleben, auf die Vermeidung einer humanitären Krise und auf die Vermeidung der Bildung jihadistischer Gruppen, so war sie definitiv kein Erfolg. In der Zeit von 2011 bis 2015 wurde aus Libyen ein instabiler, vom Bürgerkrieg zerrissener Staat, ungefähr 11.000 Menschen verloren ihr Leben (ebd., S. 70 – 72) und Libyens Demokratisierung ist nicht einmal einer Erwähnung wert. Stattdessen wurde aus Libyen ein Safe Haven für Terroristen, die in erster Linie die Sicherheit Europas bedrohen – zusätzlich zu den Bedrohungen, die vom Bürgerkrieg in Syrien und dem Krieg in der Ostukraine ausgehen.
Nichtsdestotrotz ist die Verantwortung der NATO für die Entwicklung Libyens in der Post-Gaddafi-Ära stark in Zweifel zu ziehen. Wenngleich es unbestreitbar ist, dass die NATO daran scheiterte, die aktuellen Entwicklungen im Vorfeld zu verhindern, bedeutet das nicht, dass ausschließlich die Allianz dafür verantwortlich ist und die libysche Zentralregierung nicht. Zu behaupten, es wäre alleine die Schuld der NATO, dass Libyen derart zerfallen ist, tut nicht nur dem Verteidigungsbündnis unrecht. Dieses Argument verleugnet zudem die Handlungsmacht und Verantwortlichkeit Libyens.
Der Sturz Gaddafis
Dennoch müssen auch die Fakten anerkannt werden: Ohne die Intervention der NATO hätte Gaddafis Regime wahrscheinlich nicht geendet und der libysche Staat wäre wahrscheinlich nicht zerfallen. Dies liegt vor allem an der hochgradig personalisierten Herrschaft Gaddafis, dessen profundes Misstrauen gegenüber verschiedensten Institutionen es war, welches für das Fehlen staatlicher Institutionen und Strukturen sorgte. Dieses Fehlen staatlicher Strukturen stürzte Libyen nach dem Sturz Gaddafis ins Chaos stützte.
Bourguiba favoured institutions and a robust bureaucracy, while Gaddafi distrusted institutions and sought to dismantle every union and club.
Hisham Matar, The Guardian
Das Scheitern verschiedener Gruppierungen dabei, sich auf ein System parlamentarischer Repräsentation zu einigen sowie Wahlen zu organisieren resultierte im Zusammenbruch Libyens. Anders als Tunesien, das sich auf seine Gewerkschaften und vor allem sein Militär verlassen konnte, nutzte Gaddafi in Libyen die Interessen verschiedener arabischer Stämme geschickt aus und verließ sich vor allem auf seine eigene Elitetruppe. Der jetzige Bürgerkrieg geht auf diese fehlenden Institutionen zurück, über die Streitigkeiten kanalisiert hätten werden können, wären sie stärker gewesen.
Juan Cole beschreibt das Gaddafi-Regime als eine arabische Form des Stalinismus. Totale Kontrolle über die Gesellschaft, über Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken oder Universitäten, über das Militär. (Juan Cole, „The New Arabs. How the Millennial Generation Is Changing the Middle East“, New York, Simon & Schuster, S. 228) Gaddafi selbst verließ sich vor allem auf seine Elitetruppe, die Revolutionsgarde. Diese paramilitärische Organisation paralysierte die libysche Gesellschaft für eine lange Zeit:
A couple of days later, Khaled kindly took me to meet the historian and physician Muhammad al-Mufti. […] The dapper, gentlemanly al-Mufti received us in his book-lined study. As I looked at the shelves and shelves of books, I thought of the story the new head of the National Library in Benghazi told me. He said that in the early 1980s Qaddafi appointed a general to run the library. The man was dismissive of books. ’All we need,’ he declared, ’is the Green Book.’
Juan Cole, “The New Arabs”, S. 230
Hier setzt Kuperman an: Gaddafi sei notwendig gewesen für das Überleben des libyschen Staates und ausgehend davon, dass er die libysche Bevölkerung für die Revolte gegen seine Herrschaft nicht bestraft hätte, sei eine Intervention gar nicht nötig gewesen (Kuperman 2015, S. 70 – 72). Außerdem sei der Vorkriegs-Gaddafi ein Verbündeter der Vereinigten Staaten im Kampf gegen Terrorismus gewesen. Darüber hinaus, so Kuperman weiter, sei überhaupt nicht damit zu rechnen gewesen, dass das Regime tatsächlich jene Gräueltaten verüben würde, derer es verdächtigt wurde und welche die Intervention letzten Endes rechtfertigten (ebd.). Doch so sicher ist dies nicht. Gaddafi war bis zu einem gewissen Grad unberechenbar – wer hätte also mit Sicherheit sagen können, was das Regime tun oder nicht tun würde?
Bewaffnete Milizen
Die eigentlichen Nachkriegsprobleme Libyens begannen erst, als die Milizen, die im Bürgerkrieg gekämpft hatten, sich weigerten, ihre Waffen der Zentralregierung zu übergeben. Darüber hinaus war die weite Verbreitung von Waffen, die sich in den Händen verschiedener Milizen mit unterschiedlichen Interessen befanden, zentral. Eine Entwaffnung dieser Gruppen hätte es wesentlich einfacher gemacht, unter anderem für UNSMIL, den politischen Prozess voranzubringen. Stattdessen begannen die Kämpfe von Neuem. Bereits im November 2011 bemerkte David D. Kirkpatrick in der New York Times:
Many of the local militia leaders who helped topple Col. Muammar el-Qaddafi are abandoning a pledge to give up their weapons and now say they intend to preserve their autonomy and influence political decisions as “guardians of the revolution.”
David D. Kirkpatrick, The New York Times
Es ist klar, dass diese Milizen keine unüberlegte Entscheidung trafen, sondern sich dazu entschieden, auf diese Weise eine starke Rolle innerhalb des politischen Prozesses zu spielen. Es ist ein Fakt, dass sich der Nationale Übergangsrat, der seine Kompetenzen am 08. August 2012 einer neugewählten Versammlung übertrug, zwischen der Integration der Milizen in den politischen Prozess oder deren Bekämpfung entscheiden musste. In keinem Fall hätte der libysche Staat es zulassen können, dass alternative Machtquellen existieren, die sein Gewaltmonopol infrage stellen. Die Weigerung der Milizen, ihre Waffen abzugeben und ihre Weigerung, ein Teil der libyschen Streitkräfte zu werden, war ein Dilemma, das ohne gewaltsames Vorgehen nicht aufzulösen war.
Vor diesem Hintergrund muss die Operation Dignity gegen den von Islamisten dominierten Nationalkongress in Tripolis und gegen Islamistische Milizen in Benghazi gesehen werden. Nur 18 Prozent der libyschen Wählerinnen und Wähler hatten an der Wahl zum Abgeordnetenrat teilgenommen, der eine neue Regierung bilden sollten. Es überrascht nicht, dass die islamistischen Parteien das Wahlergebnis ablehnten. Diese instabile Situation, in der niemand über ein eindeutiges Gewaltmonopol verfügt und in welcher es täglich zu Konflikten zwischen den Milizen selbst kommt, bildete den Nährboden für terroristische Gruppen wie dem sogenannten „Islamischen Staat“.
Unvermeidbare Fehler
Kupermans Argumentation ist nicht unverständlich, ganz im Gegenteil. Die NATO hätte in der Tat ihre Responsibility to Protect besser wahrnehmen und Libyens Entwicklung in einen gescheiterten Staat verhindern können. Dennoch überzeugt seine Argumentation nicht davon, dass keine Intervention seitens der internationalen Gemeinschaft besser gewesen wäre.
In der Tat sind der Nordatlantik-Allianz zwei Fehler unterlaufen, die allerdings nicht vermeidbar waren bzw. der Situation geschuldet waren. Einerseits kam die Intervention zeitlich zu spät und andererseits dauerte sie nicht lange genug, um eine effektive Transformation zu Frieden und Demokratie herzustellen. So hätte eine frühere Intervention vermutlich den Zerfall der Rebellen in viele verschiedene Milizen vorbeugen können, wodurch die NATO der heutigen Fragmentierung bis zu einem gewissen Grad vorbeugen hätte können. Eine längere Intervention andererseits hätte es ermöglicht, die Milizen zu entwaffnen und den politischen Prozess zu sichern.
Beide Varianten waren allerdings unvermeidbar, denn Russland und China haben im UN-Sicherheitsrat erst einer Resolution zugestimmt, als zugesichert wurde, dass nach dem Ende der Intervention keine Besatzungstruppen im Land bleiben würden. Dies zu ignorieren hätte einen Verstoß gegen das Mandat des UN-Sicherheitsrats bedeutet. Die Alternative wäre gewesen, ein neues Mandat nach Kapitel VI der UN-Charta anzustreben, um den politischen Prozess militärisch absichern zu können – etwas, das realpolitisch unmöglich war.
Keine Intervention wäre nicht zwingend besser gewesen
Es stimmt zwar, dass die NATO-Intervention in Libyen nach hinten losgegangen sein mag, insbesondere was den Schutz von Zivilisten betrifft. Das Regime hatte kurz davorgestanden, den Krieg zu gewinnen, was ein rasches Ende dieses Konflikts bedeutet und den Zerfall des libyschen Staats verhindert hätte. Als Konsequenz des andauernden Bürgerkriegs zirkulierten an dessen späterem Ende eine Vielzahl Klein- und Leichtwaffen sowie die entsprechende Munition.
Allerdings ist es fraglich, dass sich die Situation für die libysche Bevölkerung verbessert hätte, wäre Gaddafi an der Macht geblieben. Letzten Endes hätte Gaddafis Herrschaft geendet und sein Sohn, Saif al-Islam, wäre der neue Anführer der libyschen Regierung geworden. Dieser hätte eine reformistische Agenda gehabt – aber das ist ebenfalls keine Garantie für Veränderungen. Immerhin hatte auch der Sohn des syrischen Diktators Hafez al-Assad, der jetzige Präsident Syriens Bashar al-Assad, eine reformistische Agenda und war dereinst die größte Hoffnung auf eine Demokratisierung Syriens.
Hätte die NATO nicht eingegriffen, Gaddafi wäre wohl der Herrscher in Libyen geblieben. Hätte er an den Aufständischen ein Exempel statuieren lassen? Das werden wir nicht mehr erfahren.
Beitragsbild: Alexandros Michailidis/Shutterstock